Babylon Mesopotanien Göttin Ishtar Lilitu Biblische Lilith 1800BC Schrein Tafel





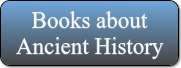
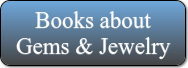
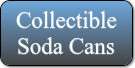






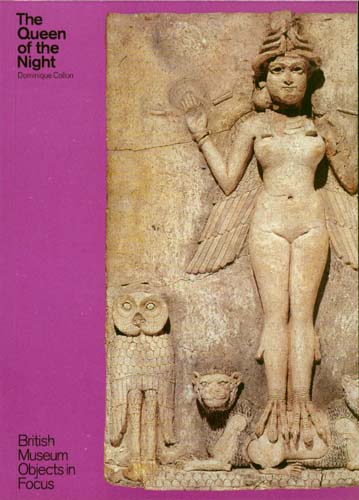
„Die Königin der Nacht“ von Dominique Collon.
HINWEIS: Wir haben 75.000 Bücher in unserer Bibliothek, fast 10.000 verschiedene Titel. Die Chancen stehen gut, dass wir noch andere Exemplare desselben Titels in unterschiedlichem Zustand haben, manche günstiger, manche besser. Möglicherweise haben wir auch verschiedene Ausgaben (einige Taschenbuchausgaben, einige gebundene Ausgaben, oft auch internationale Ausgaben). Wenn Sie nicht finden, was Sie möchten, kontaktieren Sie uns bitte und fragen Sie nach. Gerne senden wir Ihnen eine Übersicht über die unterschiedlichen Konditionen und Preise, die wir für den gleichen Titel haben können.
BESCHREIBUNG: Weiche Abdeckung. Herausgeber: Britisches Museum (2005). Seiten: 48. Größe: 8¼ x 5¾ Zoll.
Übersicht: Diese große altbabylonische Gedenktafel, die im Südirak gefunden wurde, wurde zwischen 1800 und 1750 v. Chr. angefertigt. Sie besteht aus gebranntem, strohgehärtetem Ton, ist in einem Hochrelief modelliert und stand wahrscheinlich in einem Schrein. Die Figur könnte ein Aspekt der Göttin Ischtar sein, der mesopotamischen Göttin der sexuellen Liebe und des Krieges; oder Ishtars Schwester und Rivale, die Göttin Ereshkigal, die über die Unterwelt herrschte; oder die Dämonin Lilitu, in der Bibel als Lilith bekannt.
Dieses Buch untersucht die Symbolik und Geschichte hinter diesem wunderschönen Relief. Die Figur trägt den gehörnten Kopfschmuck einer mesopotamischen Gottheit und hält einen Stab und einen Ring der Gerechtigkeit in der Hand, Symbole ihrer Göttlichkeit. Ihre langen, mehrfarbigen Flügel hängen nach unten und weisen darauf hin, dass sie eine Göttin der Unterwelt ist. Ihre Beine enden in den Krallen eines Raubvogels, ähnlich denen der beiden Eulen, die sie flankieren.
Der Hintergrund war ursprünglich schwarz bemalt, was darauf hindeutet, dass sie mit der Nacht in Verbindung gebracht wurde. Sie steht auf dem Rücken zweier Löwen und ein Schuppenmuster deutet auf Berge hin. Möglicherweise gelangte das Relief bereits 1924 nach England und wurde 1933 zur wissenschaftlichen Untersuchung ins British Museum gebracht. Das Relief befand sich bis zu seinem Erwerb durch das Museum im Jahr 2003 in Privatbesitz.
BEDINGUNG: NEU. Neues übergroßes Softcover. British Museum (2005) 48 Seiten. Makellos, ohne Markierungen, makellos in jeder Hinsicht. Die Seiten sind makellos; sauber, klar, ohne Markierungen, unversehrt, fest gebunden, eindeutig ungelesen. Zufriedenheit bedingungslos garantiert. Auf Lager, versandfertig. Keine Enttäuschungen, keine Ausreden. STARK GEPOLSTERT, BESCHÄDIGUNGSFREIE VERPACKUNG! Sorgfältige und genaue Beschreibungen! Verkauf seltener und vergriffener alter Geschichtsbücher online seit 1997. Wir akzeptieren Rücksendungen aus beliebigem Grund innerhalb von 30 Tagen! #9170a.
SIEHE BESCHREIBUNGEN UND BILDER UNTEN FÜR DETAILLIERTE BEWERTUNGEN UND SEITEN MIT BILDERN AUS DEM BUCH.
BITTE SEHEN SIE SICH UNTEN DIE REZENSIONEN VON VERLAGERN, PROFIS UND LESER AN.
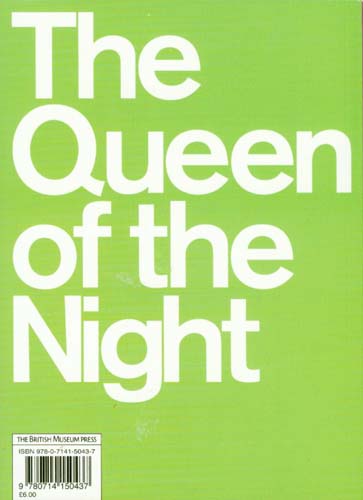
VERLAGSBEWERTUNGEN:
ÜBERPRÜFEN: Ein prägnantes und wunderschön gestaltetes Buch, das die Symbolik hinter einer exquisiten antiken babylonischen Gedenktafel untersucht, die im Südirak gefunden wurde. Diese spektakuläre Terrakottatafel war die wichtigste Anschaffung zum 250-jährigen Jubiläum des British Museum und wurde 2004 in verschiedenen Museen im Vereinigten Königreich ausgestellt. Sie wurde zwischen 1800 und 1859 v. Chr. hergestellt, besteht aus gebranntem, strohgehärtetem Ton und ist im Hochrelief modelliert.
Es stand wahrscheinlich in einem Schrein und könnte die Dämonin Lilitu, in der Bibel als Lilith bekannt, oder eine mesopotamische Göttin darstellen. Die Figur trägt den gehörnten Kopfschmuck, der für eine mesopotamische Gottheit charakteristisch ist, und hält einen Stab und einen Ring der Gerechtigkeit in der Hand, Symbole ihrer Göttlichkeit. Ihre langen, mehrfarbigen Flügel hängen nach unten und weisen darauf hin, dass sie eine Göttin der Unterwelt ist. Das Buch untersucht die Geschichte und Symbolik hinter diesem wunderschönen und höchst ungewöhnlichen Relief.
ÜBERPRÜFEN: Burney Relief/Königin der Nacht. Rechteckige Reliefplatte aus gebranntem Ton; Auf der Vorderseite ist ein Relief modelliert, das eine nackte weibliche Figur mit spitz zulaufenden gefiederten Flügeln und Krallen zeigt, die mit zusammengelegten Beinen dasteht. ganz frontal dargestellt, mit einem Kopfschmuck bestehend aus vier Paar Hörnern, gekrönt von einer Scheibe; an jedem Handgelenk eine aufwendige Halskette und Armbänder tragen; ihre Hände mit jeweils einem Stab und einem Ring auf Schulterhöhe haltend; Die Figur wird von einem Paar hinzugefügter Löwen über einem Schuppenmuster getragen, das Berge oder hügeliges Gelände darstellt, und flankiert von einem Paar stehender Eulen. gebrannter Ton, stark mit Spreu oder anderen organischen Stoffen temperiert; hervorgehoben mit rotem und schwarzem Pigment und möglicherweise weißem Gips; flache Rückseite; repariert.
Die wissenschaftliche Analyse der Pigmente zeigt, dass am Körper der weiblichen Hauptfigur in großem Umfang roter Ocker verwendet wurde. Es ist wahrscheinlich, dass in einigen Gebieten Gips als Weißpigment verwendet wurde, obwohl die Möglichkeit, dass Gips durch Ausblühungen von im Grundwasser enthaltenen Salzen vorhanden ist, nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Die dunklen Bereiche im Hintergrund enthielten alle Kohlenstoff und nicht wie zuvor angenommen Bitumen. Die Form und Grundzusammensetzung einer großen zentralen Figur, die von zwei kleinen Figuren flankiert wird, erinnert an eine Gipstafel, die dem frühen zweiten millennium v. Chr. zugeschrieben und 1910 in Assur gefunden wurde. Weitere Belege für das frühe 2. Jahrtausend. Zu den bemalten Tonskulpturen aus Mesopotamien gehört ein Kopf im Nationalmuseum in Kopenhagen.
Ein ähnliches Motiv findet sich auf Terrakottatafeln, von denen auch ein Schimmelpilz erhalten ist. Dieses Motiv taucht seltsamerweise auch auf Reproduktionen römischer Terrakottalampen auf, die in der Westtürkei verkauft werden (von denen es ein Exemplar in der registrierten ANE-Ephemera-Sammlung gibt) sowie in beliebten modernen westlichen Kulten. Der Begriff „Königin der Nacht“ wurde bereits früher auch für eine Figur in Mozarts „Zauberflöte“ verwendet, für die David Hockney in der Glyndebourne-Inszenierung 1978 ägyptische Bühnenbilder schuf; kommt in einem Lied von Whitney Houston vor und ist der Name von mindestens einer Art nachtblühender Orchideenkakteen, dem Epiphyllum oxypetallum. Herr Sakamoto fügte am unteren Rand des Objekts eine japanische Inschrift und das Datum 1975 hinzu, als es sich in seinem persönlichen Besitz befand. [Britisches Museum].
ÜBERPRÜFEN: Diese große altbabylonische Gedenktafel, die im Südirak gefunden wurde, wurde zwischen 1800 und 1750 v. Chr. angefertigt. Es besteht aus gebranntem, strohgehärtetem Ton, ist in einem Hochrelief modelliert und stand wahrscheinlich in einem Schrein. Dieses Buch untersucht die Symbolik und Geschichte hinter diesem wunderschönen Relief.
ÜBERPRÜFEN: Dominique Collon ist stellvertretender Bewahrer in der Abteilung für den Alten Nahen Osten am British Museum. Sie ist Autorin von „Ancient Near Eastern Art“, „First Impressions: Zylindersiegel im alten Nahen Osten“, „Interpreting the Past: Near Eastern Seals“ und zwei Katalogen der Zylindersiegel in der Sammlung des British Museum.
ÜBERPRÜFEN: Dominique Collon ist Kurator der mesopotamischen Sammlungen im British Museum.
INHALTSVERZEICHNIS:
Karten.
1. Von „Burney Relief“ bis „Queen of the Knight“.
2. Die „Königin der Nacht“ erschaffen.
3. Die „Königin der Nacht“ und ihre Begleiter.
4. Wer war die „Königin der Nacht“?
Weiterführende Literatur.
Bildnachweis.
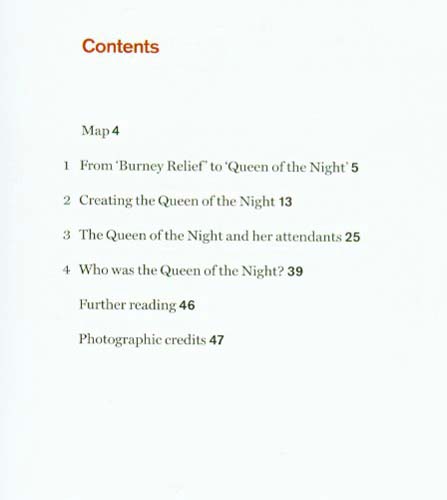
PROFESSIONELLE BEWERTUNGEN:
ÜBERPRÜFEN: Im Irak wurde eine große altbabylonische Gedenktafel gefunden. Dieses Buch untersucht die Symbolik und Geschichte hinter diesem wunderschönen Relief. Die Figur trägt den gehörnten Kopfschmuck einer mesopotamischen Gottheit und hält einen Stab und einen Ring der Gerechtigkeit in der Hand, Symbole ihrer Göttlichkeit. Ihre Beine enden in den Krallen eines Raubvogels und sie steht auf dem Rücken zweier Löwen. Sehr empfehlenswert. Kompakter, fundierter Text, atemberaubende Fotografie. [The Telegraph (UK)].
ÜBERPRÜFEN: Wer ist diese Dame? Die Antworten finden Sie in diesem außergewöhnlichen und reich bebilderten kleinen Buch. [ArtNewsletter.com].
LESERBEWERTUNGEN:
ÜBERPRÜFEN: Dieses Buch ist Teil einer Reihe von Kurzführern, die vom British Museum herausgegeben wurden. Es ist sehr aufschlussreich, obwohl sich die endgültige Identifizierung der geflügelten und vogelfüßigen Göttin als nicht schlüssig erwies. Die Hauptanwärter waren Ištar, Lilith und Erishkigal. Die Fotos sind ausgezeichnet und die Farbrekonstruktion der Gedenktafel ist wirklich beeindruckend. Ich glaube, dass die Figur im Relief ein göttlicher Lilu ist. Sie waren dafür bekannt, nachts Männer und Frauen zu besuchen und mit ihnen zu schlafen. Ihr Liebesspiel könnte offenbar zur Geburt von Kindern führen, denn in der sumerischen Königsliste heißt es tatsächlich, dass ein Lilu-Dämon der Vater von Gilgamesch war.
ÜBERPRÜFEN: Die Buchreihe, zu der dies gehört, ist fabelhaft. Das British Museum kennt seine Kunden sicherlich. Ein interessanter Fokus auf nur ein Objekt im Museum. Und es gibt noch viele weitere, die die interessantesten Stücke im Museum abdecken. Eine gut geschriebene Broschüre über „Die Königin der Nacht“ mit archäologischen und historischen Informationen sowie tollen Illustrationen.
ÜBERPRÜFEN: Ein guter Kurzführer zur Königin der Nacht. Es handelt sich um eine Broschüre, nicht um ein vollständiges Buch. Vor diesem Hintergrund sind die Informationen sehr gut und die Bilder von ausgezeichneter Qualität.
ZUSÄTZLICHER HINTERGRUND:
ÜBERPRÜFEN: Die Königin der Nacht (auch als Burney-Relief bekannt) ist eine hochreliefierte Terrakottatafel aus gebranntem Ton mit den Maßen 19,4 Zoll (49,5 cm) hoch, 14,5 Zoll (37 cm) breit und 1,8 Zoll (4,8 cm) dick ) zeigt eine nackte geflügelte Frau, die von Eulen flankiert wird und auf dem Rücken zweier Löwen steht. Sie entstand im Süden Mesopotamiens (dem heutigen Irak), höchstwahrscheinlich in Babylonien, während der Herrschaft von Hammurabi (1792-1750 v. Chr.), da sie handwerkliche und technische Qualitäten mit der berühmten Diorit-Stele von Hammurabis Gesetzen und auch mit dem als bekannt genannten Stück teilt „Der Gott von Ur“ aus derselben Zeit. Die abgebildete Frau gilt als Göttin, da sie den gehörnten Kopfschmuck einer Gottheit trägt und das heilige Stab-und-Ring-Symbol in ihren erhobenen Händen hält. Es besteht jedoch keine Einigkeit darüber, wer die geflügelte Frau ist, obwohl Gelehrte im Allgemeinen davon ausgehen, dass es sich bei ihr entweder um Inanna (Ishtar), Lilith oder Ereshkigal handelt. [Das Britische Museum].
ÜBERPRÜFEN: Die Königin der Nacht (auch als Burney-Relief bekannt) war eine wichtige Anschaffung zum 250-jährigen Jubiläum des British Museum. Diese große Gedenktafel besteht aus gebranntem, strohgehärtetem Ton und ist im Hochrelief modelliert. Die Figur der kurvenreichen nackten Frau war ursprünglich rot bemalt. Sie trägt den gehörnten Kopfschmuck einer mesopotamischen Gottheit und hält einen Stab und einen Ring der Gerechtigkeit in der Hand, Symbole ihrer Göttlichkeit. Ihre langen, mehrfarbigen Flügel hängen nach unten und weisen darauf hin, dass sie eine Göttin der Unterwelt ist.
Ihre Beine enden in den Krallen eines Raubvogels, ähnlich denen der beiden Eulen, die sie flankieren. Der Hintergrund war ursprünglich schwarz bemalt, was darauf hindeutet, dass sie mit der Nacht in Verbindung gebracht wurde. Sie steht auf dem Rücken zweier Löwen und ein Schuppenmuster deutet auf Berge hin. Die Figur könnte ein Aspekt der Göttin Ishtar sein, der mesopotamischen Göttin der sexuellen Liebe und des Krieges, oder Ishtars Schwester und Rivalin, der Göttin Ereshkigal, die über die Unterwelt herrschte, oder der Dämonin Lilitu, in der Bibel als Lilith bekannt. Die Gedenktafel stand wahrscheinlich in einem Schrein.
Dieselbe Göttin erscheint auf kleinen, groben, geformten Tafeln aus Babylonien aus der Zeit um 1850 bis 1750 v. Chr. Thermolumineszenztests bestätigen, dass das Relief „Königin der Nacht“ zwischen 1765 und 45 v. Chr. angefertigt wurde. Das Relief dürfte bereits 1924 nach England gelangt sein und 1933 zur wissenschaftlichen Untersuchung ins British Museum gebracht worden sein. Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1936 in den Illustrated London News ist es nach seinem damaligen Besitzer als „Burney Relief“ bekannt. Bis 2003 war es in Privatbesitz. Der Direktor und das Kuratorium des British Museum beschlossen, diese spektakuläre Terrakottatafel zur Hauptanschaffung zum 250-jährigen Jubiläum des British Museum zu machen. [Das Britische Museum].
ÜBERPRÜFEN: Die Königin der Nacht (auch als „Burney-Relief“ bekannt) ist eine hochreliefierte Terrakottatafel aus gebranntem Ton, 19,4 Zoll (49,5 cm) hoch, 14,5 Zoll (37 cm) breit und 1,8 Zoll dick ( 4,8 cm) zeigt eine nackte geflügelte Frau, die von Eulen flankiert wird und auf dem Rücken zweier Löwen steht. Sie entstand im Süden Mesopotamiens (dem heutigen Irak), höchstwahrscheinlich in Babylonien, während der Herrschaft von Hammurabi (1792–1750 v. Chr.), da sie handwerkliche und technische Qualitäten mit der berühmten Diorit-Stele von Hammurabis Gesetzen und auch mit dem als „“ bekannten Stück teilt Der Gott von Ur‘ aus derselben Zeit.
Die im Relief dargestellte Frau gilt als Göttin, da sie den gehörnten Kopfschmuck einer Gottheit trägt und das heilige Stab-und-Ring-Symbol in ihren erhobenen Händen hält. Die Frau ist nicht nur geflügelt, sondern ihre Beine verjüngen sich auch zu Vogelkrallen (die den Rücken des Löwen zu umklammern scheinen) und sie wird mit einer Taukralle an den Waden dargestellt. Entlang der Basis der Tafel verläuft ein Motiv, das Berge darstellt und auf eine Anhöhe hinweist. Es besteht jedoch keine Einigkeit darüber, wer die geflügelte Frau ist, obwohl Gelehrte allgemein davon ausgehen, dass es sich bei ihr entweder um Inanna (Ishtar), Lilith oder Ereshkigal handelt. Das Stück ist derzeit Teil der Sammlung des British Museum, Raum 56, in London.
Im Jahr 1936 n. Chr. wurde das Burney-Relief in den Illustrated London News vorgestellt und hob die Sammlung eines Sydney Burney hervor, der die Gedenktafel kaufte, nachdem das British Museum das Kaufangebot weitergeleitet hatte. Da das Stück nicht archäologisch ausgegraben, sondern einfach irgendwann zwischen den 1920er und 1930er Jahren aus dem Irak entfernt wurde, sind sein Ursprung und Kontext unbekannt. Wie die Gedenktafel nach London gelangte, ist ebenfalls unbekannt, sie befand sich jedoch im Besitz eines syrischen Antiquitätenhändlers, bevor Sydney Burney darauf aufmerksam wurde.
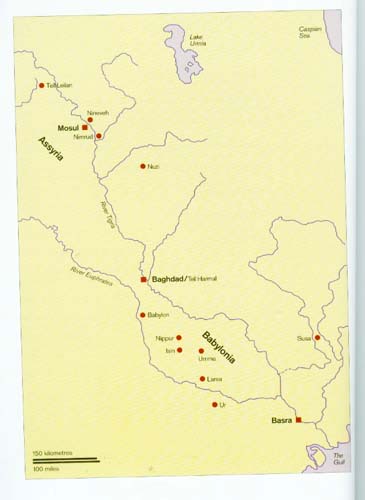
Über Sydney Burney ist nicht viel bekannt, außer dass er im Ersten Weltkrieg Hauptmann der englischen Armee und Präsident der Antique Dealers Association in London war. Die Plakette war beim ursprünglichen Kauf in drei Teile und einige Fragmente zerbrochen, erwies sich jedoch nach der Reparatur als größtenteils intakt. Das Burney-Relief wurde 1933 analysiert und 1935 authentifiziert, bevor es dem British Museum angeboten wurde. Anschließend wechselte die Plakette zweimal den Besitzer, bevor das British Museum sie schließlich im Jahr 2003 für die Summe von 1.500.000 Pfund erwarb, ein deutlich höherer Preis als 1935 verlangt.
Zu dieser Zeit wurde das als Burney-Relief bekannte Stück aufgrund des dunkelschwarzen Pigments des ursprünglichen Hintergrunds der Tafel und der Ikonographie (die nach unten gerichteten Flügel, die Krallenfüße usw.) „Die Königin der Nacht“ genannt. Assoziation der weiblichen Figur mit der Unterwelt. Der Name ist daher eine moderne und keine antike Bezeichnung für die Gedenktafel. Es gibt keine Möglichkeit zu wissen, wie das Stück ursprünglich hieß oder für welchen Zweck es geschaffen wurde. Das Relief wurde aus Ton gefertigt und mit Spreu versetzt, um das Material zu binden und Risse zu verhindern.
Die Tatsache, dass das Stück in einem Ofen gebrannt und nicht in der Sonne getrocknet wurde, zeugt von seiner Bedeutung, da auf diese Weise nur die bedeutendsten Kunstwerke und Architekturwerke entstanden. Da Holz in Südmesopotamien knapp war, wurde es nicht ohne weiteres zum Brennen von Tongegenständen verwendet. Laut Dr. Dominique Collon vom British Museum wurde die Gedenktafel wie folgt hergestellt: „...Ton wurde in eine Form gepresst und in der Sonne trocknen gelassen...die Figur bestand aus ziemlich steifem Ton, der gefaltet und in eine speziell geformte Form geschoben wurde.“ Form, mit mehr Ton hinzugefügt und dahinter gedrückt, um die Plakette zu formen. Somit ist die Figur der Königin fester Bestandteil der Gedenktafel und wurde ihr später nicht hinzugefügt. "
„Nach dem Trocknen wurde die Plakette aus der Form genommen, die Details in den lederharten Ton geschnitzt und die Oberfläche geglättet. Diese geglättete Oberfläche ist an bestimmten Stellen noch sichtbar, insbesondere in der Nähe des Nabels der Königin ... Die Ränder der Plakette wurden mit einem Messer beschnitten. Dann wurde die Tafel gebacken.“ Sobald das Stück fertig gebacken und abgekühlt war, wurde es mit einem schwarzen Hintergrund, der Frau und den Eulen in Rot und den Löwen in Weiß mit schwarzen Mähnen bemalt. Die Stab-Ring-Symbole, die Halskette der Frau und ihr Kopfschmuck waren aus Gold. Die ursprünglichen Farbspuren sind noch heute auf dem Stück zu erkennen, obwohl sie im Laufe der Jahrhunderte weitgehend abgenutzt sind.
Auch wenn nie genau bekannt ist, wo das Stück hergestellt wurde, zu welchem Zweck oder welche Göttin es darstellt, sind die Ähnlichkeiten in der Technik zwischen ihm und dem sogenannten „Gott von Ur“ so auffällig, dass spekuliert wurde, dass das Sein Ursprungsort ist die sumerische Stadt Ur. Dr. Collon bemerkt: „Der Gott aus Ur kommt der Königin der Nacht in Qualität, Verarbeitung und ikonografischen Details so nahe, dass er durchaus aus derselben Werkstatt stammen könnte, vielleicht aus Ur, wo umfangreiche Überreste aus der altbabylonischen Zeit ausgegraben wurden.“ zwischen 1922 und 1934.
Die Person, die die Gedenktafel ursprünglich entfernt hat, könnte also Mitglied eines der Ausgrabungsteams während dieser Zeit gewesen sein oder einfach jemand, der auf das Stück gestoßen ist, nachdem es freigelegt wurde. Theorien über seine ursprüngliche Platzierung und Bedeutung wurden von jedem Gelehrten, der es studiert hat, vorgeschlagen. Da in ganz Mesopotamien heilige Prostitution praktiziert wurde, glaubte der Historiker Thorkild Jacobsen, dass die Gedenktafel Teil eines Schreins in einem Bordell war. Dr. Collon stellt jedoch fest, dass „wenn dem so wäre, es sich um eine Einrichtung von sehr hoher Klasse gehandelt haben muss, wie die außergewöhnliche Qualität des Stücks beweist“.
Sie stellt außerdem die Theorie auf, dass die Gedenktafel an einer Wand aus Lehmziegeln, wahrscheinlich in einem Gehege, aufgehängt worden wäre und dass die gebrannte Terrakottatafel beim Einsturz der Lehmziegelmauer relativ intakt geblieben wäre. Die Tatsache, dass das Stück über 3000 Jahre überlebt hat, beweist, dass es ziemlich früh nach dem Einsturz oder der Aufgabe des Gebäudes, in dem es untergebracht war, begraben wurde, weil es so vor Witterungseinflüssen und Vandalismus geschützt war. Die Identität der Königin ist der faszinierendste Aspekt des Stücks und wie oben erwähnt wurden drei Kandidaten vorgeschlagen: Inanna, Lilith und Ereshkigal. Das Motiv der nackten Frau war in ganz Mesopotamien beliebt.
Der Historiker Jeremy Black bemerkt: „Handgefertigte Tonfiguren nackter Frauen tauchen in prähistorischen Zeiten in Mesopotamien auf; sie haben aufgebrachte und bemalte Merkmale.“ Figuren nackter Frauen, die einer Ton- oder Steinform nachempfunden wurden, tauchen erstmals zu Beginn des zweiten millennium v. Chr. auf ... Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie eine universelle Muttergöttin darstellen, obwohl sie möglicherweise dazu gedacht waren, die Fruchtbarkeit zu fördern.“ Inanna wäre es die Göttin im Einklang mit einer Gedenktafel, die die Fruchtbarkeit fördert, da sie über Liebe und Sex (und auch Krieg) herrschte, aber es gibt eine Reihe von Problemen mit dieser Identifizierung.
Akzeptiert man die Erkenntnisse von Dr. Black und anderen, die ihm zustimmen, dann stellt dies ein Problem mit Inanna als Königin der Nacht dar, da sie nicht allgemein als Muttergöttin angesehen wurde, wie es Ninhursag (auch bekannt als Ninhursaga) war . Ninhursag war die Mutter der Götter und wurde vom Volk als die große Muttergöttin angesehen. Es gibt auch Probleme mit Inanna als Königin, die sich aus der Ikonographie des Stücks ergeben. Während Inanna mit Löwen in Verbindung gebracht wird, wird sie nicht mit Eulen in Verbindung gebracht. Der Kopfschmuck und die Stab-und-Ring-Symbole würden zu Inanna passen, ebenso wie die Halskette, aber nicht die Flügel oder die Krallenfüße und die Tauklaue.
Der Gelehrte Thorkild Jacobsen, der sich für Inanna als Königin ausspricht, stellt vier Aspekte der Gedenktafel vor, die auf die Identität der Königin hinweisen: 1) Löwen sind ein Attribut von Inanna. 2) Die Berge unter den Löwen spiegeln die Tatsache wider, dass Inannas ursprüngliche Heimat auf den Berggipfeln im Osten Mesopotamiens lag. 3) Inanna nahm den Stab und den Ring bei ihrem Abstieg in die Unterwelt mit und ihre Halskette identifizierte sie als Hure. 4) Ihre Flügel, Vogelkrallen und Eulen zeigen, dass Inanna in ihrem Aspekt der Eulengöttin und Göttin der Huren dargestellt wird.
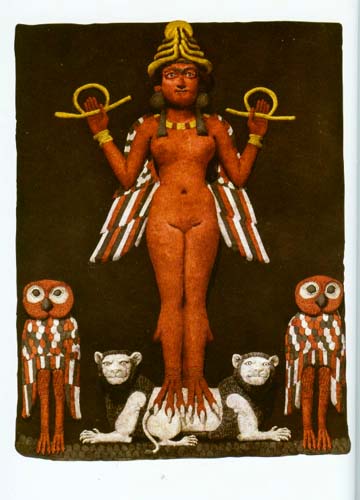
Dr. Collon weist diese Behauptungen jedoch zurück und weist darauf hin, dass Inanna „mit einem Löwen in Verbindung gebracht wird, nicht mit zwei“, und der Punkt bezüglich des Stab-und-Ring-Symbols und der Halskette kann außer Acht gelassen werden, da sie „von jedem getragen oder gehalten werden könnten“. Göttin". Dr. Collon weist auch darauf hin, dass „das erste veröffentlichte Foto des Reliefs der Königin der Nacht im Jahr 1936 lautete: ‚Ishtar … die sumerische Göttin der Liebe, deren unterstützende Eulen ein Problem darstellen‘“. Ishtar war der spätere Name für Inanna und obwohl Eulen in Geschichten über die Göttin erwähnt wurden, waren sie nie Teil ihrer Ikonographie. Darüber hinaus wird Inanna in keiner antiken Kunst frontal dargestellt, sondern immer im Profil, und die Bergkette am unteren Rand der Tafel könnte ebenfalls für eine Identifizierung mit Ereshkigal oder Lilith sprechen.
Lilith ist ein Dämon, keine Göttin, und obwohl es eine gewisse Assoziation des Lilith-Dämons mit Eulen gibt, handelt es sich nicht um die gleiche Art von Eulen, die auf dem Relief erscheint. Darüber hinaus stammt Lilith aus der hebräischen Tradition, nicht aus der mesopotamischen, und entspricht nur den mesopotamischen weiblichen Dämonen, die als Lilitu bekannt sind. Die Lilitu- und die sogenannten Ardat-Lili-Dämonen waren besonders gefährlich für Männer, die sie verführen und zerstören würden. Die männlichen Dämonen dieser Art, die Lilu, jagten Frauen und stellten eine besondere Bedrohung für Schwangere oder Wöchnerinnen sowie für Säuglinge dar. Der Artikel „The Burney Relief: Inanna, Ishtar oder Lilith?“ erklärt, warum die Lilith-Identifikation eine Wahrscheinlichkeit ist.
Rafael Patai („Die hebräische Göttin“, dritte Auflage) berichtet, dass im sumerischen Gedicht „Gilgamesch und der Huluppu-Baum“ eine Dämonin namens Lilith ihr Haus im Huluppu-Baum am Ufer des Euphrat baute, bevor sie von Gilgamesch in die Flucht geschlagen wurde. Patai beschreibt dann die Burney-Tafel: „Ein babylonisches Terrakotta-Relief, ungefähr zeitgleich mit dem oben genannten Gedicht, zeigt, in welcher Form Lilith den menschlichen Augen erscheinen sollte. Sie ist schlank, wohlgeformt, schön und nackt, mit Flügeln und Eulenfüßen. Sie steht aufrecht auf zwei liegenden, voneinander abgewandten Löwen, die von Eulen flankiert werden. Auf dem Kopf trägt sie eine Mütze, die mit mehreren Hörnerpaaren verziert ist. In ihren Händen hält sie eine Kombination aus Ring und Stab. Offensichtlich handelt es sich hierbei nicht mehr um eine einfache Dämonin, sondern um eine Göttin, die wilde Tiere zähmt und, wie die Eulen auf den Reliefs zeigen, nachts herrscht.
Dennoch ist die Möglichkeit, dass die Plakette der Königin der Nacht mit ihrem hohen Maß an handwerklichem Können und Liebe zum Detail eine Darstellung einer Lilitu sein könnte, höchst unwahrscheinlich. Der hebräischen Überlieferung zufolge war Lilith die erste von Gott geschaffene Frau, die sich weigerte, Adams sexuellen Forderungen nachzugeben, flog und sich so gegen Gott und seine Pläne für die Menschen auflehnte. Es wurde angenommen, dass sie damals das Ödland bewohnte und wie die Lilitu seitdem Jagd auf ahnungslose Männer machte. In beiden Traditionen war die Lilitu nicht beliebt genug, um auf einer Gedenktafel wie der Königin der Nacht dargestellt zu werden.
Dr. Black bemerkt: „Böse Götter und Dämonen werden in der Kunst nur sehr selten dargestellt, vielleicht weil man dachte, dass ihre Bilder Menschen gefährden könnten.“ Es wird auch angenommen, dass die am unteren Rand des Reliefs abgebildete Bergkette eine Lilith-Identifikation nahelegt, da sie die Wildnis darstellt, in der der Geist lebt, aber der Kopfschmuck, die Halskette, die Stab-und-Ring-Symbole und die Bedeutung der Gedenktafel sprechen allesamt gegen Lilith als Möglichkeit. Die dritte Anwärterin ist Inannas ältere Schwester Ereshkigal, die Königin der Großen Tiefe. Ihr Name bedeutet „Herrin des Großen Ortes“ und bezieht sich auf das Land der Toten, und es gibt eine Reihe von Aspekten auf der Gedenktafel, die darauf hindeuten, dass Ereshkigal die beste Kandidatin für die Königin ist.
Das Motiv der nach unten gerichteten Flügel wurde in ganz Mesopotamien verwendet, um auf eine Gottheit oder ein Geistwesen hinzuweisen, das mit der Unterwelt in Verbindung gebracht wird, und die Königin hat solche Flügel. Ereshkigal lebte im Unterweltpalast von Ganzir, der sich vermutlich in den östlichen Bergen befand, was die abgebildete Bergkette am unteren Rand der Gedenktafel erklären würde. Über Ganzir und die Unterwelt schreibt Dr. Collon: „Es war ein dunkler Ort und die Toten, nackt oder mit Flügeln wie Vögeln bekleidet, wanderten ohne zu trinken und nur mit Staub zum Essen umher.“ Was auch immer sie im Leben erreicht hatten, das einzige Urteil war der Tod, ausgesprochen von Ereshkigal.“
Ereshkigal wird in dem Gedicht „Inannas Abstieg in die Unterwelt“ bekanntlich nackt dargestellt: „Über ihren Körper war kein Leinen ausgebreitet. Ihre Brüste waren unbedeckt. Ihr Haar wirbelte wie Lauch um ihren Kopf“ (Wolkstein und Kramer , 65) und die Königin auf der Gedenktafel ist nackt. Darüber hinaus wird die Königin im Gegensatz zu Darstellungen von Inanna im Profil von vorne gezeigt. Dr. Collon schreibt: „Als Göttin hatte Ereshkigal Anspruch auf den gehörnten Kopfschmuck und das Stab-und-Ring-Symbol.“ Ihre Frontalität ist statisch und unveränderlich, und als Königin der Unterwelt, in der „das Schicksal entschieden wurde“, war sie das ultimative Urteil: Sie hätte durchaus Anspruch auf zwei Stab-und-Ring-Symbole gehabt.“ Auf die gleiche Weise sind die Löwen die Königin steht, könnte Ereshkigals Vormachtstellung über die mächtigsten Lebewesen darstellen und die Eulen könnten mit ihrer Assoziation mit der Dunkelheit mit dem Land der Toten in Verbindung gebracht werden. Die gesamte Ikonographie der Gedenktafel der Königin der Nacht scheint darauf hinzudeuten, dass es sich bei der dargestellten Gottheit um Ereshkigal handelt, aber wie Dr. Collon feststellt, „kann keine eindeutige Verbindung zu Ereshkigal hergestellt werden, da keine Ikonographie bekannt ist: Ihre Verbindung mit dem Tod machte sie zu einer unbeliebtes Thema“ (45). Da es keine bekannte Ikonographie von Ereshkigal gibt, mit der man die Königin der Nacht vergleichen könnte, bleibt die Identität der Königin ein Rätsel. [Enzyklopädie der antiken Geschichte]
ÜBERPRÜFEN: Raum 56 des British Museum; Mesopotamien: Eine große Vitrine beherbergt das „Relief der Königin der Nacht“. Es ist eines der Meisterwerke des British Museum, auch bekannt als „Burney Relief“. Diese Terrakottatafel stammt aus Mesopotamien (größtenteils dem heutigen Irak) und stammt aus der altbabylonischen Zeit, 1800-1750 v. Chr. Ich stand einen Meter von der Vitrine entfernt und beobachtete die Besucher des British Museum; Was werden sie tun, wenn sie dieser „Königin“ begegnen? Im Allgemeinen machten sie einige Fotos von ihr und einige Selfies. Sie verbrachten mehr oder weniger eine Minute. Jetzt war ich an der Reihe. Ich näherte mich dem Fall; Das Glas war sehr sauber und transparent.
Ich werde meine Gedanken als Arzt zum Ausdruck bringen, der die anatomischen Details einer etwa 4000 Jahre alten Frau untersucht hat. Ich bin beratender Neurologe, kein Anatom, aber ich habe Anatomie an der medizinischen Fakultät studiert. Ich habe jeden einzelnen Zentimeter des Queen's Relief unter die Lupe genommen und einige Bilder geschossen. Die weibliche Figur wird so dargestellt, als ob sie lebendig wäre; eine sehr attraktive und nackte Frau. Die Augenhöhlen sind hohl (möglicherweise mit einem anderen Material eingelegt). Die Augenbrauen sind relativ dick und treffen in der Mittellinie aufeinander; ein Stil, der immer noch von vielen irakischen Frauen verwendet wird.

Die Wangen sind voll, die Lippen dünn und die Mundwinkel nach oben gezogen (mit einem schüchternen Lächeln). Ihre Nasen- und Kinnspitzen sind gebrochen. Das rechte Außenohr (oder die Ohrmuschel) ist erhalten geblieben und seine Länge erstreckt sich vom äußeren Augenwinkel (dem äußeren Winkel, in dem beide Augenlider aufeinandertreffen) bis zum Mundwinkel (perfekte menschliche Anatomie). Bei näherer Betrachtung des Gesichts der weiblichen Gottheit fallen die hohlen Augen, die vollen Wangen und die zusammengefügten Augenbrauen auf. Das obere linke Horn ihres Kopfschmucks und der linke Haarknoten sind verloren.
Ein Teil ihrer Stirn ist sichtbar, weil sie einen vierstufigen Kopfschmuck aus Hörnern (Symbol der Göttlichkeit) trägt. Der Kopfschmuck wird von einer Scheibe gekrönt. Das linke Oberhorn ist verloren. Unter dem Kopfschmuck liegen die Haare der Kopfhaut. Allerdings ist der Großteil ihres „langen“ Haares auf beiden Seiten in zwei Knoten geteilt (der linke ist verloren). Der Rest des Haares ist zu zwei Zöpfen zusammengebunden, die auf beiden Seiten der oberen Brustwand und an einer einzigen breiten Halskette herunterreichen. Was für eine vielseitige Frisur sie hat! Ein Teil der rechten Hälfte der Halskette ist verloren.
Der Hals ist relativ schmal und nicht so kurz. Die Schultern sind schmal und relativ abfallend. Die Brüste sind voll und erhöht und ihre äußeren Ränder reichen über die äußere (laterale) Brustwand hinaus. Es gibt keine Spaltung. Obwohl es keine Brustwarzen gibt, wurden beide Warzenhöfe (der kleine pigmentierte Kreis um die Brustwarze) durch ein dunkles Pigment hervorgehoben. Beide Achselhöhlen sind deutlich dargestellt. Die Arme sind symmetrisch nach oben gehoben und die Innenseite beider Hände ist dem Betrachter zugewandt; die Handflächenfalten sind sehr deutlich abgegrenzt.
Die Daumen befinden sich in einer adduzierten Position (Addukt: nach innen zur Mittelachse des Körpers oder zu einem angrenzenden Teil oder Glied ziehen) und halten ein Stab-und-Ring-Symbol (das rechte fehlt), das ebenfalls ein Symbol ist göttlicher Macht. An beiden Handgelenken befinden sich Armbänder aus Ringen; An der Basis des linken Daumens sind noch Spuren roter Farbe zu erkennen. Unterhalb der Brust beginnt der Bauch, der schmaler wird und dessen Außenränder konkav sind. Dann wird das Becken breiter dargestellt als der mittlere Bauchbereich; eine sehr weibliche Einstellung.
Der Nabel (Nabel; Bauchnabel) befindet sich in seiner perfekten anatomischen Position; Es liegt in der Mitte einer imaginären horizontalen Linie, die die Oberseite beider Beckenkämme (den oberen Außenrand des knöchernen Beckens) verbindet. Diese Knochenkämme zeigen sich als konvexe Wölbungen am äußeren Rand des oberen Beckens. Der Schambereich hat eine perfekt dreieckige Form und ist nach innen gebogen. Beide Oberschenkel sind sehr eng adduziert und treffen sich in der Mittellinie. Zwischen den Innenseiten beider Kniegelenke befindet sich ein kleiner spindelförmiger Raum. An jedem Kniegelenk finden wir eine Patella (Kniescheibe).
Etwas unterhalb der Kniegelenke ragen an der Seitenfläche beider Oberschenkel kleine dreieckige Vorsprünge hervor; sie erscheinen als Afterkrallen. An den Knöcheln verwandeln sich die Füße des Weibchens in die eines Vogels. Jeder Fuß besteht aus drei gleich langen, aber getrennten Zehen. Am Knöchel und an den Zehen finden wir mehrere Kratzer; Dabei handelt es sich höchstwahrscheinlich um Scutes. Die Zehen sind aufgefächert und die Füße ruhen auf dem Rücken zweier Löwen, die von zwei großen Eulen flankiert werden.
Die Königin hat zwei Flügel. Die Flügel sind teilweise dreieckig ausgebreitet. Die Flügel sind in einem sehr gut abgegrenzten und stilisierten Federregister dargestellt. Beide Flügel reichen von knapp über den Schultern bis zum oberen Teil beider Oberschenkel. Die Flügel sind sehr ähnlich, aber nicht symmetrisch; Sie unterscheiden sich in der Anzahl der Federn und ihrer Farbe. Das obere Register hat verdeckte Federn, während die übrigen unteren Register lange Schwungfedern enthalten. Beide Löwen liegen auf dem Rücken und blicken mit geschlossenem Maul dem Betrachter entgegen. Die Gesamtform der Eulen weist darauf hin, dass sie nicht aus dem Fruchtbaren Crescent stammen.
Sie alle, die weibliche Gottheit und ihre Gefährten, stehen dem Betrachter gleichzeitig würdevoll gegenüber. Die Gesamtszene ist atemberaubend, besonders wenn man sie im Profil betrachtet. Ich habe allein bei diesem Relief mehr als eine Stunde verbracht! Wer war der Künstler/Bildhauer, der diese wundervolle, charmante, charismatische und liebenswerte Frau geschaffen hat? Hat der Künstler dieses Werk geschaffen, während eine nackte Frau als Modell vor ihm lag? Hat der Künstler Anatomie studiert? Ich mag Kim Kardashian, aber ich liebe diese Königin der Nacht! Wenn Sie das British Museum besuchen, vergessen Sie nicht, nach oben zu gehen (Raum 56) und ihre majesty zu treffen! [Enzyklopädie der antiken Geschichte].
ÜBERPRÜFEN: Das Burney-Relief (auch als Relief der Königin der Nacht bekannt) ist eine mesopotamische Terrakottatafel im Hochrelief aus der Isin-Larsa- oder altbabylonischen Zeit, die eine geflügelte, nackte, göttinnenähnliche Figur mit Vogelkrallen flankiert darstellt von Eulen und auf zwei Löwen sitzend. Das Relief ist im British Museum in London ausgestellt, das es auf die Zeit zwischen 1800 und 1750 v. Chr. datiert. Es stammt aus Südmesopotamien, der genaue Fundort ist jedoch unbekannt.
Abgesehen von seiner charakteristischen Ikonographie zeichnet sich das Stück durch sein hohes Relief und seine relativ große Größe aus, was darauf hindeutet, dass es als Kultrelief verwendet wurde, was es zu einem sehr seltenen Überbleibsel aus dieser Zeit macht. Ob es sich jedoch um Lilitu, Inanna/Ishtar oder Ereshkigal handelt, ist umstritten. Die Echtheit des Objekts wurde seit seinem ersten Erscheinen in den 1930er Jahren angezweifelt, doch in den folgenden Jahrzehnten hat sich die Meinung im Allgemeinen zu seinen Gunsten entwickelt. Ursprünglich im Besitz eines syrischen Händlers, der die Gedenktafel möglicherweise 1924 im Südirak erworben hatte, wurde das Relief im British Museum in London deponiert und 1933 von Dr. HJ Plenderleith analysiert.
Das Museum lehnte jedoch 1935 den Kauf ab, woraufhin die Plakette an den Londoner Antiquitätenhändler Sidney Burney überging; es wurde später als „Burney Relief“ bekannt. Das Relief wurde erstmals 1936 durch eine ganzseitige Reproduktion in The Illustrated London News der Öffentlichkeit bekannt gemacht. Von Burney gelangte es in die Sammlung von Norman Colville, nach dessen Tod es vom japanischen Sammler Goro Sakamoto versteigert wurde. Die britischen Behörden verweigerten ihm jedoch eine Exportlizenz. Das Stück wurde zwischen 1980 und 1991 zur Ausstellung an das British Museum ausgeliehen, und 2003 kaufte das Museum das Relief im Rahmen seiner 250-Jahr- celebrations für 1.500.000 £.
Das Museum benannte die Gedenktafel auch in „Relief der Königin der Nacht“ um. Seitdem tourt das Objekt durch Museen in ganz Großbritannien. Leider ist seine ursprüngliche Herkunft unbekannt. Das Relief wurde nicht archäologisch ausgegraben, daher liegen uns keine weiteren Informationen darüber vor, woher es stammte oder in welchem Kontext es entdeckt wurde. Eine Interpretation des Reliefs beruht daher auf stilistischen Vergleichen mit anderen Objekten, deren Entstehungsdatum und -ort festgestellt wurde, auf einer Analyse der Ikonographie und auf der Interpretation von Textquellen aus der mesopotamischen Mythologie und Religion.
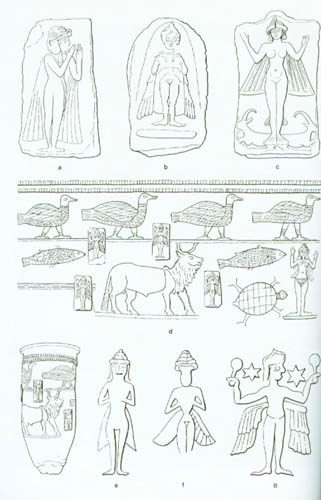
Ausführliche Beschreibungen wurden von Henri Frankfort (1936), von Pauline Albenda (2005) und in einer Monographie von Dominique Collon, Kurator am British Museum, wo sich die Gedenktafel heute befindet, veröffentlicht. Die Gesamtkomposition ist unter Kunstwerken aus Mesopotamien einzigartig, auch wenn viele Elemente interessante Entsprechungen in anderen Bildern aus dieser Zeit haben. Das Relief ist eine Terrakotta-Plakette (gebrannter Ton), 50 x 37 Zentimeter (20 x 15 Zoll) groß, 2 bis 3 Zentimeter (3/4 bis 1 1/4 Zoll) dick, wobei der Kopf der Figur 4,5 Zentimeter vorsteht ( 1 3/4 Zoll) von der Oberfläche entfernt. Zur Herstellung des Reliefs wurde Ton mit kleinen Kalkeinschlüssen mit Spreu vermischt; Sichtbare Falten und Risse deuten darauf hin, dass das Material bei der Bearbeitung recht steif war.
Die Abteilung für wissenschaftliche Forschung des British Museum berichtet: „Es scheint wahrscheinlich, dass die gesamte Plakette geformt wurde“, wobei anschließend einige Details modelliert und andere hinzugefügt wurden, wie zum Beispiel die Stab-und-Ring-Symbole, die Haarsträhnen und die Augen von die Eulen. Anschließend wurde das Relief brüniert und poliert und mit einem spitzen Werkzeug weitere Details eingeschnitten. Durch das Brennen wurde die Spreu verbrannt und es blieben charakteristische Hohlräume und die narbige Oberfläche zurück, die wir heute sehen; Curtis und Collon glauben, dass die Oberfläche in der Antike durch ockerfarbene Farbe geglättet aussah. In ihren Abmessungen ist die einzigartige Gedenktafel größer als die massenhaft hergestellten Terrakottatafeln – Volkskunst- oder Devotionalien –, von denen viele in Hausruinen der Isin-Larsa- und altbabylonischen Zeit ausgegraben wurden.
Insgesamt ist das Relief in ausgezeichnetem Zustand. Es wurde ursprünglich in drei Teilen und einigen Fragmenten vom British Museum erhalten; Nach der Reparatur sind noch einige Risse sichtbar, insbesondere fehlt ein dreieckiges Stück am rechten Rand, aber die Hauptmerkmale der Gottheit und der Tiere sind intakt. Das Gesicht der Figur weist Schäden an der linken Seite, der linken Nasenseite und der Halsregion auf. Der Kopfschmuck weist an der Vorder- und rechten Seite einige Schäden auf, die Gesamtform lässt sich jedoch aus der Symmetrie ableiten. Die Hälfte der Halskette fehlt und das Symbol der Figur, die sie in der rechten Hand hält; Die Schnäbel der Eulen sind verloren und ein Stück eines Löwenschwanzes.
Ein Vergleich der Bilder aus den Jahren 1936 und 2005 zeigt, dass auch einige moderne Schäden entstanden sind: Die rechte Seite der Krone hat jetzt ihre oberste Stufe verloren, und in der unteren linken Ecke ist ein Stück des Bergmusters abgesplittert und das Eule hat ihre rechten Zehen verloren. In allen wichtigen Aspekten ist das Relief jedoch mehr als 3.500 Jahre lang intakt geblieben. Auf dem ursprünglich insgesamt rot bemalten Körper der Figur sind noch Spuren von rotem Pigment vorhanden. Die Federn ihrer Flügel und die Federn der Eulen waren ebenfalls rot gefärbt, abwechselnd mit Schwarz und Weiß. Durch Raman-Spektroskopie wird das rote Pigment als roter Ocker, das schwarze Pigment als amorpher Kohlenstoff („Lampenschwarz“) und das weiße Pigment als Gips identifiziert.
Schwarze Pigmente finden sich auch auf dem Hintergrund der Plakette, den Haaren und Augenbrauen sowie auf den Mähnen der Löwen. Das Schambeindreieck und der Warzenhof erscheinen mit rotem Pigment akzentuiert, wurden aber nicht separat schwarz bemalt. Die Körper der Löwen waren weiß bemalt. Die Kuratoren des British Museum gehen davon aus, dass die Hörner des Kopfschmucks und eines Teils der Halskette ursprünglich gelb gefärbt waren, so wie sie es auch bei einer sehr ähnlichen Tonfigur aus Ur sind. Sie vermuten, dass die Armbänder und die Stab-und-Ring-Symbole ebenfalls gelb bemalt waren. Auf dem Relief sind jedoch keine Spuren von gelbem Pigment mehr vorhanden.
Die nackte weibliche Figur ist realistisch im Hochrelief modelliert. Ihre Augen unter deutlichen, zusammengefügten Augenbrauen sind hohl, vermutlich um eingelegtes Material aufzunehmen – ein Merkmal, das bei Stein-, Alabaster- und Bronzeskulpturen dieser Zeit häufig vorkommt, bei anderen mesopotamischen Tonskulpturen jedoch nicht zu sehen ist. Ihre vollen Lippen sind an den Mundwinkeln leicht nach oben gezogen. Sie ist mit einem vierstufigen Kopfschmuck aus Hörnern geschmückt, der von einer Scheibe gekrönt wird. Ihr Kopf wird von zwei Haarzöpfen umrahmt, wobei der Großteil ihrer Haare im Nacken zu einem Knoten zusammengebunden ist und zwei keilförmige Zöpfe bis zu ihren Brüsten reichen.
Die stilisierte Bearbeitung ihrer Haare könnte eine zeremonielle Perücke darstellen. Sie trägt eine einzelne breite Halskette, die aus Quadraten besteht, die mit horizontalen und vertikalen Linien strukturiert sind und möglicherweise vier Perlen pro Quadrat darstellen. Diese Halskette ist praktisch identisch mit der Halskette des Gottes, die in Ur gefunden wurde, mit der Ausnahme, dass die Halskette des letzteren drei Linien zu einem Quadrat aufweist. Um beide Handgelenke trägt sie Armbänder, die aus drei Ringen zusammengesetzt zu sein scheinen. Beide Hände sind symmetrisch nach oben gehoben, die Handflächen sind dem Betrachter zugewandt und mit sichtbaren Lebens-, Kopf- und Herzlinien versehen. Sie halten zwei Stab-und-Ring-Symbole, von denen nur das in der linken Hand gut erhalten ist.
Über ihren Schultern erstrecken sich zwei Flügel mit klar definierten, stilisierten Federn in drei Registern. Die Federn im oberen Register sind als überlappende Schuppen (Verstecke) dargestellt, die unteren beiden Register haben lange, versetzte Schwungfedern, die mit einem Lineal gezeichnet wirken und in einer konvexen Hinterkante enden. Die Federn haben glatte Oberflächen; Es wurden keine Widerhaken gezogen. Die Flügel sind ähnlich, aber nicht ganz symmetrisch und unterscheiden sich sowohl in der Anzahl der Schwungfedern als auch in den Details der Farbgebung. Ihre Flügel sind dreieckig ausgebreitet, aber nicht vollständig ausgestreckt. Die Brüste sind voll und hoch, jedoch ohne separat modellierte Brustwarzen.
Ihr Körper wurde mit Liebe zum naturalistischen Detail geformt: der tiefe Nabel, der strukturierte Bauch, der „sanft modellierte Schambereich“, die geschwungene Kontur der Hüfte unterhalb des crest und die knöcherne Struktur der Beine mit ausgeprägten Kniescheiben deuten auf „eine künstlerische Fähigkeit hin, die mit ziemlicher Sicherheit auf beobachtetem Studium beruht“. Von ihren Waden direkt unterhalb des Knies erstreckt sich ein spornartiger Vorsprung, eine Falte oder ein Büschel, den Collon als Afterkrallen interpretiert. Unterhalb des Schienbeins verwandeln sich die Beine der Figur in die eines Vogels. Die Vogelfüße sind detailliert und haben drei lange, gut getrennte Zehen von ungefähr gleicher Länge.
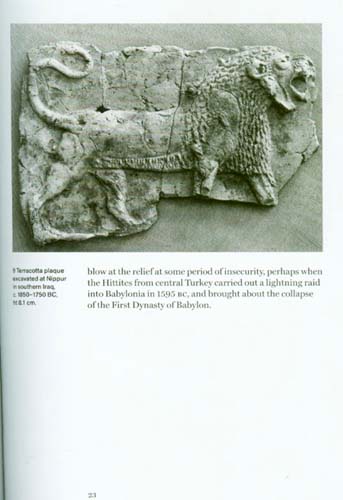
In die Oberfläche des Knöchels und der Zehen wurden Linien geritzt, um die Rillen darzustellen, und alle sichtbaren Zehen haben hervorstehende Krallen. Ihre Zehen sind nach unten gestreckt, ohne perspektivische Verkürzung; Sie scheinen nicht auf einer Grundlinie zu ruhen und verleihen der Figur so den Eindruck, als ob sie vom Hintergrund gelöst wäre, als würde sie schweben. Die beiden Löwen haben eine männliche Mähne, gemustert mit dichten, kurzen Linien; Die Mähnen setzen sich unter dem Körper fort. Aus den Ohren des Löwen und auf seinen Schultern wachsen deutlich gemusterte Haarbüschel, die von einem zentralen scheibenförmigen Wirbel ausgehen.
Sie liegen in Bauchlage, ihre Köpfe sind mit Liebe zum Detail geformt, aber mit einer gewissen künstlerischen Freiheit in ihrer Form, z. B. was ihre runden Formen betrifft. Beide Löwen blicken zum Betrachter, beide haben ihr Maul geschlossen. Die abgebildeten Eulen sind erkennbar, aber nicht naturalistisch geformt: Die Form des Schnabels, die Länge der Beine und Details des Gefieders weichen von denen der in der Region heimischen Eulen ab. Ihr Gefieder ist wie die Flügel der Gottheit in Rot, Schwarz und Weiß gefärbt; es ist bilateral ähnlich, aber nicht perfekt symmetrisch. Beide Eulen haben auf der rechten Seite ihres Gefieders eine Feder mehr als auf der linken Seite. Die Beine, Füße und Krallen sind rot.
Die Gruppe ist auf einem schwarz bemalten Schuppenmuster platziert. Auf diese Weise wurden Bergketten in der mesopotamischen Kunst häufig symbolisiert. Stilistische Vergleiche verorten das Relief frühestens in der Isin-Larsa-Zeit oder etwas später in den Beginn der altbabylonischen Zeit. Frankfort weist insbesondere auf die stilistische Ähnlichkeit mit dem in Ur gefundenen skulptierten Kopf einer männlichen Gottheit hin, der laut Collon „der Königin der Nacht in Qualität, Verarbeitung und ikonografischen Details so nahe kommt, dass er durchaus aus derselben Werkstatt stammen könnte“. ." Daher ist Ur eine mögliche Herkunftsstadt des Reliefs, aber nicht die einzige.
Edith Porada weist auf die virtuelle Stilidentität hin, die die Haarbüschel des Löwen haben, und zwar mit dem gleichen Detail, das auf zwei Fragmenten von Tontafeln zu sehen ist, die in Nippur ausgegraben wurden. Und Agnès Spycket berichtete von einer ähnlichen Halskette auf einem in Isin gefundenen Fragment. Ein Entstehungsdatum zu Beginn des zweiten millennium v. Chr. ordnet das Relief einer Region und Zeit zu, in der die politische Situation instabil war, gekennzeichnet durch den zunehmenden und schwindenden Einfluss der Stadtstaaten Isin und Larsa, eine Invasion der Elamiter usw schließlich die Eroberung durch Hammurabi bei der Einigung im babylonischen Reich 1762 v
Drei- bis fünfhundert Jahre zuvor hatte die Bevölkerung ganz Mesopotamiens mit etwa 300.000 ihren historischen Höchststand erreicht. Elamitische Invasoren stürzten daraufhin die dritte Dynastie von Ur und die Bevölkerung sank auf etwa 200.000; Zum Zeitpunkt der Erleichterung hatte sie sich auf diesem Wert stabilisiert. Städte wie Nippur und Isin hätten etwa 20.000 Einwohner gehabt und Larsa vielleicht 40.000; Hammurabis Babylon wuchs bis 1700 v. Chr. auf 60.000 Einwohner. Um Städte dieser Größe zu erhalten, sind eine gut entwickelte Infrastruktur und eine komplexe Arbeitsteilung erforderlich.
Die Herstellung religiöser Bilder könnte von spezialisierten Handwerkern durchgeführt worden sein: Es wurden zahlreiche kleinere Andachtstafeln ausgegraben, die in Formen hergestellt wurden. Obwohl die fruchtbaren crescent als die ältesten in der Geschichte gelten, standen zum Zeitpunkt der Herstellung des Burney-Reliefs auch andere Zivilisationen der Spätbronzezeit in voller Blüte. Reisen und kultureller Austausch waren nicht alltäglich, aber dennoch möglich. Im Osten befand sich Elam mit seiner Hauptstadt Susa häufig in militärischen Konflikten mit Isin, Larsa und später Babylon. Darüber hinaus hatte die Indus-Tal-Zivilisation ihren Höhepunkt bereits überschritten und in China blühte die Erlitou-Kultur auf.
Im Südwesten wurde Ägypten von der 12. Dynastie regiert, weiter westlich dominierte die minoische Zivilisation mit ihrem Zentrum auf Kreta und dem Alten Palast in Knossos das Mittelmeer. Nördlich von Mesopotamien errichteten die anatolischen Hethiter ihr altes Königreich über den Hattianern; Sie beendeten Babylons Reich mit der Plünderung der Stadt im Jahr 1531 v. Chr. Tatsächlich erwähnt Collon diesen raid möglicherweise als Grund für die Beschädigung der rechten Seite des Reliefs.
Die Größe der Gedenktafel lässt darauf schließen, dass sie in einen Schrein gehörte, möglicherweise als Kultobjekt; es war wahrscheinlich in eine Lehmziegelmauer eingelassen. Ein solcher Schrein könnte ein spezieller Raum in einem großen Privathaus oder einem anderen Haus gewesen sein, aber nicht der Hauptschwerpunkt der Verehrung in einem der Tempel der Stadt, der rund geformte Darstellungen von Göttern enthalten hätte. Mesopotamische Tempel hatten damals eine rechteckige Cella, oft mit Nischen auf beiden Seiten. Laut Thorkild Jacobsen könnte sich dieser Schrein in einem Bordell befunden haben.
Verglichen mit der Bedeutung der Religionsausübung in Mesopotamien und der Anzahl der vorhandenen Tempel sind nur sehr wenige Kultfiguren erhalten geblieben. An mangelndem künstlerischen Können liegt das sicher nicht: Der „Widder im Dickicht“ zeigt, wie aufwändig solche Skulpturen schon 600 bis 800 Jahre früher gewesen sein können. Es liegt auch nicht an mangelndem Interesse an religiöser Skulptur: Gottheiten und Mythen sind auf Rollsiegeln und den wenigen erhaltenen Stelen, Kudurrus und Reliefs allgegenwärtig.
Vielmehr erscheint es plausibel, dass die Hauptanbetungsfiguren in Tempeln und Schreinen aus so wertvollen Materialien bestanden, dass sie während der vielen Machtwechsel in der Region der Plünderung nicht entgehen konnten. Das Burney-Relief ist vergleichsweise schlicht und daher erhalten. Tatsächlich ist das Relief eine von nur zwei existierenden großen, figürlichen Darstellungen aus der altbabylonischen Zeit. Bei dem anderen handelt es sich um den oberen Teil des Kodex von Hammurabi, der tatsächlich im elamitischen Susa entdeckt und als Beute dorthin gebracht wurde.
Ein statisches, frontales Bild ist typisch für religiöse Bilder, die für den Gottesdienst bestimmt sind. Symmetrische Kompositionen sind in der mesopotamischen Kunst üblich, wenn der Kontext nicht erzählerisch ist. Auf Zylinderdichtungen wurden viele Beispiele gefunden. Üblich sind dreiteilige Arrangements eines Gottes und zweier weiterer Figuren, es gibt aber auch fünfteilige Arrangements. Insofern folgt die Erleichterung etablierten Konventionen. In Bezug auf die Darstellung ist die Gottheit mit einer naturalistischen, aber „bescheidenen“ Nacktheit geformt, die an ägyptische Göttinnenskulpturen erinnert, die mit einem klar definierten Nabel- und Schambereich, aber ohne Details geformt sind; dort weist der untere Saum eines Kleides darauf hin, dass eine gewisse Bedeckung beabsichtigt ist, auch wenn diese nicht verdeckt.
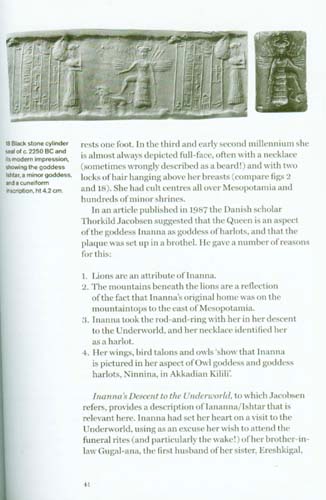
In einer typischen Statue dieses Genres werden Pharao Menkaura und zwei Göttinnen, Hathor und Bat, in Menschengestalt dargestellt und naturalistisch geformt, genau wie im Burney-Relief; Tatsächlich wurden Hathor die Züge von Königin Khamerernebty II. verliehen. Die Darstellung eines anthropomorphen Gottes als naturalistischen Menschen ist eine innovative künstlerische Idee, die möglicherweise von Ägypten nach Mesopotamien gelangt ist, ebenso wie eine Reihe von Konzepten religiöser Riten, Architektur, „Banketttafeln“ und anderer künstlerischer Innovationen zuvor. In dieser Hinsicht zeigt das Burney-Relief eine deutliche Abkehr vom schematischen Stil der anbetenden Männer und Frauen, die in Tempeln aus der Zeit vor etwa 500 Jahren zu finden waren.
Es unterscheidet sich auch vom nächsten großen Stil in der Region: der assyrischen Kunst mit ihren starren, detaillierten Darstellungen, meist von Kriegs- und Jagdszenen. Das außergewöhnliche Überleben des Figurentyps, obwohl sich Interpretationen und Kultkontext im Laufe der Jahrhunderte veränderten, kommt in der gegossenen Terrakotta-Grabfigur aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. zum Ausdruck, die aus Myrina an der Küste von Mysien in Kleinasien stammt und dort ausgegraben wurde Französische Schule in Athen, 1883; Die Terrakotta wird im Musée du Louvre aufbewahrt. Zu einer ähnlich anspruchsvollen Skulptur gehört der sumerische „Widder im Dickicht“, der von Leonard Woolley auf dem königlichen Friedhof von Ur ausgegraben und auf etwa 2600–2400 v. Chr. datiert wurde und aus Holz, Blattgold, Lapislazuli und Muscheln besteht. Das einzige andere erhaltene große Bild aus dieser Zeit: oberer Teil des Kodex von Hammurabi, ca. 1760 v. Chr. Hammurabi vor dem Sonnengott Schamasch. Dazu gehörten auch ein vierstufiger, gehörnter Kopfschmuck, das Stab-und-Ring-Symbol und das Bergkettenmuster unter Shamashs Füßen, alles aus schwarzem Basalt.
Ähnliche Göttinnendarstellungen kommen in ägyptischen Denkmälern vor. Beispielsweise findet man im Kairoer Museum die Triade der ägyptischen Göttin Hathor und der Nome-Göttin Bat, die den Pharao Menkaura anführt; aus der vierten Dynastie, etwa 2400 v. Chr. Eine typische Darstellung eines mesopotamischen Anbeters aus dem dritten millennium v. Chr., Eshnunna, aus Alabaster, datiert auf etwa 2700 v. Chr., befindet sich im New Yorker Metropolitan Museum of Art. Eine weitere assyrische Reliefgottheitsdarstellung befindet sich im Louvre. Bekannt als „Segensgeist“, ursprünglich aus dem Palast von Sargon II. und auf etwa 716 v. Chr. datiert. Im Vergleich zu bildenden Kunstwerken aus derselben Zeit passt das Relief recht gut zu seinem Darstellungsstil und seiner reichen Ikonographie.
Weitere ähnliche Darstellungen aus derselben Zeit umfassen eine Frau im Ischtar-Tempel in Mari (zwischen 2500 und 2400 v. Chr.), die im Louvre gefunden wurde. Die neosumerische Göttin Bau, ebenfalls im Louvre gefunden, Ursprung Telloh, etwa 2100 v. Chr. Auch eine geformte Gedenktafel von Ischtar, ebenfalls im Louvre gefunden, Ursprung Anfang des zweiten millennium , Eshnunna. Die „Ischtar-Vase“, frühes 2. millennium v. Chr., Larsa, ebenfalls im Louvre. Und schließlich im British Museum eine Darstellung einer Frau aus einem altbabylonischen Tempel. Die mesopotamische Religion kennt buchstäblich Tausende von Gottheiten, und für etwa ein Dutzend wurden unterschiedliche Ikonographien identifiziert. Seltener werden Götter durch ein schriftliches Etikett oder eine Widmung identifiziert; Solche Etiketten wären nur für die gebildeten Eliten gedacht gewesen.
Bei der Schaffung eines religiösen Objekts hatte der Bildhauer nicht die Freiheit, neuartige Bilder zu schaffen: Die Darstellung von Gottheiten, ihre Attribute und ihr Kontext waren ebenso Teil der Religion wie die Rituale und die Mythologie. Tatsächlich könnten Innovationen und Abweichungen von einem akzeptierten Kanon als sektiererisches Vergehen angesehen werden. Der große Grad an Ähnlichkeit, der bei Tafeln und Siegeln zu finden ist, legt nahe, dass detaillierte Ikonographien auf berühmten Kultstatuen basieren könnten; Sie begründeten die visuelle Tradition für solche abgeleiteten Werke, sind jedoch inzwischen verloren gegangen. Es scheint jedoch, dass das Burney-Relief das Produkt einer solchen Tradition und nicht ihre Quelle war, da seine Zusammensetzung einzigartig ist.
Die frontale Darstellung der Gottheit ist für eine Kulttafel angemessen, da sie nicht nur ein „bildlicher Hinweis auf einen Gott“, sondern „ein Symbol seiner Gegenwart“ ist. Da es sich bei dem Relief um die einzige existierende Gedenktafel handelt, die für den Gottesdienst bestimmt ist, wissen wir nicht, ob dies generell zutrifft. Doch diese besondere Darstellung einer Göttin stellt ein spezifisches Motiv dar: eine nackte Göttin mit Flügeln und Vogelfüßen. Ähnliche Bilder wurden auf mehreren Gedenktafeln, auf einer Vase von Larsa (oben beschrieben) und auf mindestens einem Rollsiegel gefunden. Sie stammen alle aus ungefähr derselben Zeit.
In allen Fällen bis auf eines sind die Vorderansicht, die Nacktheit, die Flügel und die gehörnte Krone Merkmale, die zusammen vorkommen; Somit sind diese Bilder in ihrer Darstellung einer bestimmten Göttin ikonographisch miteinander verbunden. Darüber hinaus sind Beispiele dieses Motivs die einzigen existierenden Beispiele eines nackten Gottes oder einer nackten Göttin; alle anderen Götterdarstellungen sind bekleidet. Die Füße des Vogels sind nicht immer gut erhalten, es gibt jedoch keine Gegenbeispiele einer nackten, geflügelten Göttin mit menschlichen Füßen. Die gehörnte Krone, meist vierstufig, ist das allgemeinste Symbol einer Gottheit in der mesopotamischen Kunst. Männliche und weibliche Götter tragen es gleichermaßen.
In manchen Fällen tragen „geringere“ Götter Kronen mit nur einem Paar Hörnern, aber die Anzahl der Hörner ist im Allgemeinen kein Symbol für „Rang“ oder Bedeutung. Die Form, die wir hier sehen, ist ein Stil, der in der neosumerischen Zeit und später beliebt war; Frühere Darstellungen zeigen Hörner, die aus einem konischen Kopfstück herausragen. Geflügelte Götter, andere Fabelwesen und Vögel sind vom 3. millennium bis zu den Assyrern häufig auf Rollsiegeln und Stelen abgebildet. Es sind sowohl zweiflügelige als auch vierflügelige Figuren bekannt, wobei die Flügel meist seitlich ausgestreckt sind. Ausgebreitete Flügel sind Teil einer Art der Darstellung von Ishtar. Die spezifische Darstellung der hängenden Flügel der nackten Göttin könnte sich jedoch aus dem ursprünglichen Umhang entwickelt haben.
Das Stab- und Ringsymbol kann die Messwerkzeuge eines Bauherrn oder Architekten oder eine symbolische Darstellung dieser Werkzeuge darstellen. Es wird häufig auf Zylindersiegeln und Stelen dargestellt, wo es immer von einem Gott gehalten wird, normalerweise entweder Schamasch, Ischtar und in späteren babylonischen Bildern auch Marduk. Das Symbol wurde oft auch auf einen König erweitert. Löwen werden hauptsächlich mit Ishtar oder den männlichen Göttern Shamash oder Ningirsu in Verbindung gebracht. In der mesopotamischen Kunst werden Löwen fast immer mit offenem Rachen dargestellt. H. Frankfort schlägt vor, dass das Burney-Relief eine Modifikation des normalen Kanons darstellt, die auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass die Löwen dem Anbeter zugewandt sind: Die Löwen könnten unangemessen bedrohlich wirken, wenn ihr Maul geöffnet wäre.
In der mesopotamischen Kunst gibt es keine weiteren Beispiele für Eulen im ikonografischen Kontext, noch gibt es Texthinweise, die Eulen direkt mit einem bestimmten Gott oder einer bestimmten Göttin in Verbindung bringen. Ein auf einem Schuppenmuster stehender oder sitzender Gott ist eine typische Szenerie für die Darstellung einer Theophanie. Es wird mit Göttern in Verbindung gebracht, die eine gewisse Verbindung zu Bergen haben, ist aber nicht auf eine bestimmte Gottheit beschränkt. Die Figur wurde zunächst als Darstellung von Ishtar (Inanna) identifiziert, doch fast sofort wurden andere Argumente vorgebracht. Die Identifizierung des Reliefs mit der Darstellung von „Lilith“ ist zu einem festen Bestandteil populärer Schriften zu diesem Thema geworden.
Raphael Patai glaubt, dass das Relief die einzige erhaltene Darstellung einer sumerischen Dämonin namens Lilitu ist und somit die Ikonographie von Lilitu definiert. Zitate zu dieser Behauptung führen auf Henri Frankfort (1936) zurück. Frankfort selbst stützte seine Interpretation der Gottheit als Dämonin Lilith auf das Vorhandensein von Flügeln, die Füße der Vögel und die Darstellung von Eulen. Er zitiert das babylonische Gilgamesch-Epos als Quelle dafür, dass solche „Geschöpfe Bewohner des Landes der Toten“ sind. In diesem Text wird Enkidus Aussehen teilweise in das eines gefiederten Wesens geändert und er wird in die Unterwelt geführt, wo Kreaturen leben, die „vogelähnlich sind und ein Federgewand tragen“.
Diese Passage spiegelt den Glauben der Sumerer an die Unterwelt wider, und Frankfort führt Beweise dafür an, dass Nergal, der Herrscher der Unterwelt, mit Vogelfüßen und in ein gefiedertes Gewand gehüllt dargestellt wird. Frankfort identifizierte die Figur jedoch nicht selbst mit Lilith; vielmehr zitiert er stattdessen Emil Kraeling (1937). Kraeling glaubt, dass die Figur „ein übermenschliches Wesen niedrigerer Ordnung“ ist; er erklärt nicht genau warum. Anschließend führt er aus: „Flügel … deuten regelmäßig auf einen Dämon hin, der mit dem Wind in Verbindung gebracht wird“ und „Eulen könnten durchaus auf die nächtlichen Gewohnheiten dieses weiblichen Dämons hinweisen.“ Er schließt Lamashtu und Pazuzu als Dämonenkandidaten aus und stellt fest: „Vielleicht haben wir hier eine dritte Darstellung eines Dämons.“ Wenn ja, muss es Lilîtu sein … der Dämon eines bösen Windes“, genannt ki-sikil-lil-la (wörtlich „Windmädchen“ oder „Phantommädchen“, nicht „schöne Jungfrau“, wie Kraeling behauptet).
Dieser Ki-Sikil-Lil ist ein Antagonist von Inanna (Ishtar) in einer kurzen Episode des Gilgamesch-Epos, die sowohl von Kraeling als auch von Frankfort als weiterer Beweis für die Identifizierung als Lilith angeführt wird, obwohl auch dieser Anhang inzwischen umstritten ist. In dieser Episode wird Inannas heiliger Huluppu-Baum von böswilligen Geistern heimgesucht. Frankfort zitiert eine vorläufige Übersetzung von Gadd (1933): „Inmitten hatte Lilith ein Haus gebaut, die kreischende Magd, die fröhliche, die strahlende Königin des Himmels.“ In modernen Übersetzungen heißt es jedoch stattdessen: „In seinem Koffer baute sich die Phantommagd eine Wohnung, die Magd, die mit freudigem Herzen lacht.“ Aber die heilige Inanna weinte.
Die frühere Übersetzung impliziert eine Assoziation des Dämons Lilith mit einer schreienden Eule und betont gleichzeitig ihre gottähnliche Natur; Die moderne Übersetzung unterstützt keines dieser Attribute. Tatsächlich schreibt Cyril J. Gadd (1933), der erste Übersetzer: „ardat lili (kisikil-lil) wird in der babylonischen Mythologie nie mit Eulen in Verbindung gebracht“ und „die jüdischen Überlieferungen über Lilith in dieser Form scheinen spät und veraltet zu sein.“ keine große Autorität“. Diese einzelne Beweislinie wurde als praktischer Beweis dafür angesehen, dass das Burney-Relief mit „Lilith“ identifiziert wurde, möglicherweise durch spätere Assoziationen von „Lilith“ in späteren jüdischen Quellen motiviert.
Die Verbindung von Lilith mit Eulen in späterer jüdischer Literatur wie den Liedern des Weisen (1. Jahrhundert v. Chr.) und dem babylonischen Talmud (5. Jahrhundert n. Chr.) geht auf einen Hinweis auf eine Lilith in einer Liste wilder Vögel und Tiere in Jesaja (7. Jahrhundert) zurück Jahrhundert v. Chr.), obwohl einige Gelehrte wie Blair (2009) den vortalmudischen Jesaja-Bezug für nicht übernatürlich halten, und dies spiegelt sich in einigen modernen Bibelübersetzungen wider:
Jesaja 34:13 „Dornen werden über seinen Burgen wachsen, Nesseln und Disteln über seinen Burgen. Es soll der Aufenthaltsort der Schakale sein, ein Aufenthaltsort für Strauße. Und wilde Tiere werden auf Hyänen treffen; die wilde Ziege wird zu ihrem Artgenossen schreien; Tatsächlich lässt sich dort der Nachtvogel (Lilit oder Lilith) nieder und findet für sich einen Ruheplatz. Dort nistet und legt und schlüpft die Eule und sammelt ihre Jungen in ihrem Schatten; tatsächlich sind dort die Falken versammelt, jeder mit seinem Partner.“ Heute wird die Identifizierung des Burney-Reliefs mit Lilith in Frage gestellt, und die Figur wird heute allgemein als Göttin der Liebe und des Krieges identifiziert.
Fünfzig Jahre später revidierte Thorkild Jacobsen diese Interpretation grundlegend und identifizierte die Figur in einer Analyse, die hauptsächlich auf Textbeweisen beruhte, als Inanna (akkadisch: Ishtar). Laut Jacobsen: „Die Hypothese, dass diese Tafel zur Anbetung geschaffen wurde, macht es unwahrscheinlich, dass ein Dämon abgebildet war.“ Dämonen hatten in der mesopotamischen Religionspraxis keinen Kult, da Dämonen „kein Essen kennen, kein Getränk kennen, kein Mehlopfer essen und kein Trankopfer trinken“. Daher konnte „mit ihnen kein Verhältnis des Gebens und Nehmens hergestellt werden“. Die gehörnte Krone ist ein Symbol der Göttlichkeit, und die Tatsache, dass sie vierstufig ist, lässt auf einen der Hauptgötter des mesopotamischen Pantheons schließen.
Inanna war die einzige Göttin, die mit Löwen in Verbindung gebracht wurde. Beispielsweise wird in einer Hymne von En-hedu-ana ausdrücklich „Inanna, sitzend auf gekreuzten (oder angeschnallten) Löwen“ erwähnt. Die Göttin ist auf Bergen stehend dargestellt. Laut Textquellen befand sich Inannas Zuhause auf Kur-mùsh, den Bergkämmen. Ikonographisch gesehen wurden auch andere Götter auf Bergschuppen dargestellt, es gibt jedoch Beispiele, in denen Inanna auf einem Bergmuster abgebildet ist, ein anderer Gott jedoch nicht, dh das Muster wurde tatsächlich manchmal zur Identifizierung von Inanna verwendet. Das Stab-und-Ring-Symbol, ihre Halskette und ihre Perücke sind Attribute, auf die im Mythos von Inannas Abstieg in die Unterwelt ausdrücklich Bezug genommen wird.
Jacobsen zitiert Textbeweise, dass das akkadische Wort eššebu (Eule) dem sumerischen Wort ninna entspricht und dass das sumerische Dnin-ninna (göttliche Dame ninna) dem akkadischen Wort Ishtar entspricht. Das sumerische Ninna kann auch als akkadisches Kilili übersetzt werden, was auch ein Name oder Beiname für Ishtar ist. Inanna/Ishtar als Hure oder Göttin der Huren war ein bekanntes Thema in der mesopotamischen Mythologie und in einem Text wird Inanna kar-kid (Hure) und ab-ba-[šú]-šú genannt, was auf Akkadisch mit kilili wiedergegeben würde. Somit scheint es eine Reihe von Metaphern zu geben, die Prostituierte und Eule mit der Göttin Inanna/Ishtar verbinden; Dies könnte den rätselhaftesten Teil des Reliefs einem bekannten Aspekt von Ishtar zuordnen.
Jacobsen kommt zu dem Schluss, dass diese Verbindung ausreichen würde, um Krallen und Flügel zu erklären, und fügt hinzu, dass die Nacktheit darauf hindeuten könnte, dass es sich bei dem Relief ursprünglich um den Hausaltar eines Bordells handelte. Im Gegensatz dazu erkennt das British Museum zwar die Möglichkeit an, dass das Relief entweder Lilith oder Ishtar darstellt, bevorzugt jedoch eine dritte Identifizierung: Ishtars Gegenspielerin und Schwester Ereshkigal, die Göttin der Unterwelt.] Diese Interpretation basiert auf der Tatsache, dass die Flügel dies nicht sind ausgebreitet und dass der Hintergrund des Reliefs ursprünglich schwarz bemalt war. Wenn dies die richtige Identifizierung wäre, wäre das Relief (und damit auch die kleineren Tafeln mit nackten, geflügelten Göttinnen) die einzige bekannte figurative Darstellung von Ereshkigal.
Edith Porada, die als erste diese Identifizierung vorschlug, bringt hängende Flügel mit Dämonen in Verbindung und stellt dann fest: „Wenn sich die vorgeschlagene Herkunft des Burney-Reliefs in Nippur als richtig erweist, muss die darauf abgebildete imposante dämonische Figur möglicherweise mit der Frau identifiziert werden.“ Herrscher der Toten oder mit einer anderen bedeutenden Figur des altbabylonischen Pantheons, die gelegentlich mit dem Tod in Verbindung gebracht wurde. Porada legte keine weiteren unterstützenden Beweise vor, doch eine andere im Jahr 2002 veröffentlichte Analyse kommt zu dem gleichen Ergebnis.
E. von der Osten-Sacken beschreibt Beweise für einen schwach entwickelten, aber dennoch bestehenden Kult für Ereshkigal; Sie zitiert Aspekte der Ähnlichkeit zwischen den Göttinnen Ishtar und Ereshkigal aus Textquellen – zum Beispiel werden sie im Mythos von „Inannas Abstieg in die Unterwelt“ „Schwestern“ genannt – und erklärt schließlich das einzigartige Doppelsymbol aus Stab und Ring in folgendermaßen: „Ereshkigal würde hier auf dem Höhepunkt ihrer Macht gezeigt werden, als sie ihrer Schwester die göttlichen Symbole und vielleicht auch ihre identifizierenden Löwen abgenommen hatte.“
Der Artikel der London Illustrated News aus dem Jahr 1936 hatte „keine Zweifel an der Echtheit“ des Objekts, das „einer umfassenden chemischen Untersuchung unterzogen“ worden war und Spuren von Bitumen zeigte, „das auf eine Weise ausgetrocknet ist, die nur im Laufe vieler Jahrhunderte möglich ist“. Stilistische Zweifel wurden jedoch nur wenige Monate später von D. Opitz geäußert, der auf die „absolute Einzigartigkeit“ der Eulen ohne Vergleichbares in allen babylonischen figurativen Artefakten hinwies. In einem aufeinanderfolgenden Artikel untersuchte E. Douglas Van Buren Beispiele sumerischer Kunst, die ausgegraben und nachgewiesen worden waren, und präsentierte Beispiele: Ischtar mit zwei Löwen, die Louvre-Plakette einer nackten, vogelfüßigen Göttin, die auf zwei Löwen steht Steinböcke und ähnliche Tafeln und sogar eine kleine Hämatit-Eule, obwohl die Eule ein isoliertes Stück ist und nicht in einem ikonografischen Kontext steht.
Ein Jahr später erkannte Frankfort Van Burens Beispiele an, fügte einige seiner eigenen hinzu und kam zu dem Schluss, „dass die Erleichterung echt ist“. Opitz (1937) stimmte dieser Meinung zu, betonte jedoch erneut, dass die Ikonographie nicht mit anderen Beispielen übereinstimme, insbesondere was das Stab-und-Ring-Symbol betrifft. Diese Symbole standen im Mittelpunkt einer Mitteilung von Pauline Albenda (1970), die erneut die Echtheit des Reliefs in Frage stellte. Anschließend führte das British Museum eine Thermolumineszenzdatierung durch, die mit der Einbrennung des Reliefs in der Antike übereinstimmte; Die Methode ist jedoch ungenau, wenn keine Proben des umgebenden Bodens zur Abschätzung der Hintergrundstrahlungswerte verfügbar sind.
Eine Widerlegung von Albenda durch Curtis und Collon (1996) veröffentlichte die wissenschaftliche Analyse; Das British Museum war von dem Relief so überzeugt, dass es es 2003 kaufte. Der Diskurs ging jedoch weiter: In ihrer ausführlichen Neuanalyse der Stilmerkmale nannte Albenda das Relief erneut „eine Pastiche künstlerischer Merkmale“ und „sei weiterhin nicht von seiner Antike überzeugt“. Ihre Argumente wurden in einer Gegenerwiderung von Collon (2007) widerlegt und insbesondere darauf hingewiesen, dass das gesamte Relief in einer Einheit geschaffen wurde, es also keine Möglichkeit gibt, dass eine moderne Figur oder Teile davon einem antiken Hintergrund hinzugefügt wurden.
Collon überprüfte auch die ikonografischen Verbindungen zu Provenienzstücken. Abschließend stellt Collon fest: „[Edith Porada] glaubte, dass eine Fälschung mit der Zeit immer schlechter aussehen würde, während ein echter Gegenstand immer besser werden würde ... Im Laufe der Jahre ist [die Königin der Nacht] tatsächlich besser geworden.“ und besser und immer interessanter. Für mich ist sie ein echtes Kunstwerk der altbabylonischen Zeit.“ 2008/09 war das Relief in Ausstellungen zu Babylon im Pergamonmuseum in Berlin, im Louvre in Paris und im Metropolitan Museum of Art in New York zu sehen. [Wikipedia].
ÜBERPRÜFEN: Ischtar war die mesopotamische Göttin der Liebe, Schönheit, des Geschlechts, des Verlangens, der Fruchtbarkeit, des Krieges, des Kampfes und der politischen Macht, das ostsemitische (akkadische, assyrische und babylonische) Gegenstück zur sumerischen Inanna und ein Verwandter der nordwestsemitischen Göttin Astarte und die armenische Göttin Astghik. Ishtar war eine wichtige Gottheit in der mesopotamischen Religion von etwa 3500 v. Chr. bis zu ihrem allmählichen Niedergang zwischen dem 1. und 5. Jahrhundert n. Chr. mit der Ausbreitung des Christentums. Ishtars Hauptsymbole waren der Löwe und der achtzackige Stern von Ishtar. Sie wurde mit dem Planeten Venus in Verbindung gebracht und übernahm viele wichtige Aspekte ihres Charakters und ihres Kults von der früheren sumerischen Göttin Inanna. Ishtars berühmtester Mythos ist die Geschichte ihres Abstiegs in die Unterwelt, die größtenteils auf einer älteren, ausführlicheren sumerischen Version mit Inanna basiert.
In der akkadischen Standardversion des Gilgamesch-Epos wird Ishtar als verwöhnte und hitzköpfige Femme Fatale dargestellt, die Gilgamesch als ihre Gemahlin verlangt. Als er sich weigert, lässt sie den Stier des Himmels los, was den Tod von Enkidu zur Folge hat. Dies steht in scharfem Kontrast zu Inannas radikal anderer Darstellung im früheren sumerischen Epos von Gilgamesch, Enkidu und der Unterwelt. Ishtar erscheint auch im hethitischen Schöpfungsmythos und in der neuassyrischen Geburtslegende von Sargon. Obwohl in verschiedenen Veröffentlichungen behauptet wurde, dass Ishtars Name die Wurzel des modernen englischen Wortes Easter sei, wurde dies von angesehenen Gelehrten abgelehnt, und solche Etymologien werden nicht in Standard-Nachschlagewerken aufgeführt.
Ishtar ist ein semitischer Name mit ungewisser Etymologie, der möglicherweise von einem semitischen Begriff abgeleitet ist, der „bewässern“ bedeutet. George A. Barton, ein früher Forscher auf diesem Gebiet, vermutet, dass der Name von „Bewässerungsgraben“ und „das, was nur durch Wasser bewässert wird“ herrührt und daher „diejenige, die bewässert“, „wird bewässert“ oder „das Selbst“ bedeutet -waterer". Unabhängig davon, welche Interpretation richtig ist, scheint der Name von Bewässerung und landwirtschaftlicher Fruchtbarkeit abgeleitet zu sein. Der Name Ischtar kommt als Element in Personennamen aus der vor- und nachsargonischen Zeit in Akkad, Assyrien und Babylonien vor. Einige Gelehrte glauben, dass Ishtar als weibliche Form des Gottes Attar entstanden sein könnte, der in Inschriften aus Ugarit und Südarabien erwähnt wird.
Der Morgenstern wurde möglicherweise als männliche Gottheit konzipiert, die über die Künste des Krieges herrschte, und der Abendstern könnte als weibliche Gottheit vorgestellt werden, die über die Künste der Liebe herrschte. Bei den Akkadiern, Assyrern und Babyloniern verdrängte der Name des männlichen Gottes schließlich den Namen seines weiblichen Gegenstücks, aber aufgrund der weitreichenden Synkretismus mit der sumerischen Göttin Inanna blieb die Gottheit weiblich, obwohl ihr Name in war die männliche Form. Die akkadische Dichterin Enheduanna, die Tochter Sargons, schrieb zahlreiche Hymnen an die sumerische Göttin Inanna, in denen sie sie mit ihrer einheimischen Göttin Ishtar identifizierte. Dies trug dazu bei, den Synkretismus zwischen den beiden zu festigen.
Es wurde angenommen, dass Ishtar die Tochter von Anu, dem Gott des Himmels, war. Obwohl sie weithin verehrt wurde, wurde sie besonders im obermesopotamischen Königreich Assyrien (heute Nordirak, Nordostsyrien und Südosttürkei) verehrt, insbesondere in den Städten Ninive, Ashur und Arbela (heute Erbil) und auch in der südmesopotamische Stadt Uruk. Ishtar war eng mit Löwen und dem achtzackigen Stern verbunden, die ihre häufigsten Symbole waren. Im babylonischen Pantheon war sie „die göttliche Personifikation des Planeten Venus“. Der Ishtar-Kult könnte mit heiliger Prostitution verbunden gewesen sein, allerdings ist dies umstritten. Felix Guirand bezeichnet ihre heilige Stadt Uruk als „Stadt der heiligen Kurtisanen“ und Ishtar selbst als „Kurtisane der Götter“.
Androgyne und hermaphroditische Männer waren stark am Ishtar-Kult beteiligt. Kurgarrū und assinnu waren Diener von Ishtar, die sich in Frauenkleidung kleideten und in Ishtars Tempeln Kriegstänze aufführten; Möglicherweise hatten sie auch homosexuellen Geschlechtsverkehr. Gwendolyn Leick, eine Anthropologin, die für ihre Schriften über Mesopotamien bekannt ist, hat diese Personen mit der zeitgenössischen indischen Hijra verglichen. In einer akkadischen Hymne wird beschrieben, dass Ishtar Männer in Frauen verwandelt. Während der Herrschaft des assyrischen Königs Assurbanipal stieg Ishtar zur wichtigsten und am meisten verehrten Gottheit im assyrischen Pantheon auf und übertraf sogar den assyrischen Nationalgott Ashur.
Während der akkadischen Zeit wurde Ishtar oft als schwer bewaffnete Kriegergöttin dargestellt, häufig begleitet von Löwen, die zu den vielen Symbolen gehörten, die Ishtar von der sumerischen Göttin Inanna übernommen hatte. In der mesopotamischen Ikonographie ist das häufigste Symbol von Ishtar ein achtzackiger Stern, obwohl die genaue Anzahl der Spitzen manchmal variiert. Sechszackige stars kommen ebenfalls häufig vor, ihre symbolische Bedeutung ist jedoch unbekannt. Der achtzackige Stern wurde ursprünglich mit Inanna in Verbindung gebracht und scheint ursprünglich eine allgemeine Assoziation mit dem Himmel gehabt zu haben, doch in der altbabylonischen Zeit wurde er speziell mit dem Planeten Venus in Verbindung gebracht, mit dem Ishtar identifiziert wurde. Seit dieser Zeit war der Stern von Ishtar normalerweise von einer kreisförmigen Scheibe umgeben.
In späteren Zeiten wurden Sklaven, die in den Tempeln von Ishtar arbeiteten, manchmal mit dem Siegel des achtzackigen Sterns gebrandmarkt. Auf Grenzsteinen und Rollsiegeln ist manchmal der achtzackige Stern neben der crescent abgebildet, die das Symbol von Sin, dem Gott des Mondes, war, und der strahlenden Sonnenscheibe, die ein Symbol von Shamash, dem Gott der Sonne, war . Die Rosette war ein weiteres wichtiges Symbol von Ishtar, das ursprünglich Inanna gehörte. Während der neuassyrischen Zeit könnte die Rosette tatsächlich den achtzackigen Stern in den Schatten gestellt haben und zum Hauptsymbol von Ishtar geworden sein. Der Ishtar-Tempel in der Stadt Aššur war mit zahlreichen Rosetten geschmückt.
Ishtar hatte viele Liebhaber; Guirand schreibt: „Wehe dem, den Ischtar geehrt hatte! Die wankelmütige Göttin behandelte ihre vorbeigehenden Liebhaber grausam, und die unglücklichen Unglücklichen zahlten normalerweise teuer für die ihnen überhäuften Gefälligkeiten. Tiere, die der Liebe versklavt waren, verloren ihre ursprüngliche Kraft: Sie fielen in von Menschen gestellte Fallen oder wurden von ihnen domestiziert. „Du hast den mächtigen Löwen geliebt“, sagt der Held Gilgamesch zu Ishtar, „und du hast ihm sieben und sieben Gruben gegraben!“ Du hast das im Kampf stolze Ross geliebt und ihn zum Halfter, zum Stachel und zur Peitsche bestimmt.‘“ Sogar für die Götter war Ishtars Liebe tödlich. In ihrer Jugend hatte die Göttin Tammuz, den Gott der Ernte, geliebt, und – wenn man Gilgamesch glauben darf – diese Liebe verursachte den Tod von Tammuz.“
Ishtars berühmtester Mythos ist die Geschichte ihres Abstiegs in die Unterwelt, die auf einer älteren sumerischen Version mit der Göttin Inanna basiert. Die sumerische Version der Geschichte ist fast dreimal so lang wie die spätere akkadische Version und enthält viel mehr Details. Die akkadische Version beginnt damit, dass Ishtar sich den Toren der Unterwelt nähert und den Torwächter auffordert, sie hereinzulassen: „Wenn du das Tor nicht öffnest, um mich eintreten zu lassen, werde ich die Tür aufbrechen, ich werde das Schloss aufbrechen; ich werde die Tür einschlagen.“ - Pfosten, ich werde die Türen aufbrechen; ich werde die Toten erwecken, um die Lebenden zu essen, und die Toten werden zahlreicher sein als die Lebenden.
In der akkadischen Version wird der Name des Torwächters nicht genannt, aber in der sumerischen Version heißt er Neti. Der Pförtner beeilt sich, es Ereshkigal, der Königin der Unterwelt, zu sagen. Ereshkigal befiehlt dem Torwächter, Ishtar eintreten zu lassen, fordert ihn jedoch auf, „sie gemäß den alten Riten zu behandeln“. Der Torwächter lässt Ishtar in die Unterwelt und öffnet ein Tor nach dem anderen. An jedem Tor muss Ishtar ein Kleidungsstück ablegen. Als sie schließlich das siebte Tor passiert, ist sie nackt. Wütend stürzt sich Ishtar auf Ereshkigal, aber Ereshkigal befiehlt ihrem Diener Namtar, Ishtar einzusperren und sechzig Krankheiten gegen sie auszulösen.
Nachdem Ishtar in die Unterwelt hinabgestiegen ist, hört jede sexuelle Aktivität auf der Erde auf. Der Gott Papsukkal, das akkadische Gegenstück zur sumerischen Göttin Ninshubur, berichtet Ea, dem Gott der Weisheit und Kultur, über die Situation. Ea erschafft ein intersexuelles Wesen namens Asu-shu-namir und schickt sie nach Ereshkigal mit der Aufforderung, „den Namen der großen Götter“ gegen sie anzurufen und um den Beutel mit den Wassern des Lebens zu bitten. Ereshkigal wird wütend, als sie Asu-shu-namirs Forderung hört, aber sie ist gezwungen, ihnen das Wasser des Lebens zu geben. Asu-shu-namir besprengt Ishtar mit diesem Wasser und belebt sie so wieder. Dann geht Ishtar durch die sieben Tore zurück, erhält an jedem Tor ein Kleidungsstück zurück und verlässt das letzte Tor vollständig bekleidet.
Hier gibt es einen Bruch im Text des Mythos, der mit den folgenden Zeilen wieder aufgenommen wird: „Wenn sie (Ishtar) dir ihre Freilassung nicht gewährt, gieße zu Tammuz, dem Liebhaber ihrer Jugend, reines Wasser aus, gieße feines Öl aus.“ ; Schmücke ihn mit einem Festgewand, damit er auf der Flöte aus Lapislazuli spielen kann, damit die Gläubigen seine Leber cheer . [sein Geist] Belili [Schwester von Tammuz] hatte den Schatz gesammelt, mit Edelsteinen, die ihren Busen füllten. Als Belili die Klage ihres Bruders hörte, ließ sie ihren Schatz fallen, sie verstreute die Edelsteine vor sich: „Oh, mein einziger Bruder, lass mich nicht zugrunde gehen!“ An dem Tag, an dem Tammuz für mich auf der Flöte aus Lapislazuli spielt und sie für mich mit dem Porphyrring spielt. Spielt mit ihm für mich, ihr Weinenden und Klagenden! Damit die Toten auferstehen und den Weihrauch einatmen können.
Früher glaubten Gelehrte, dass der Mythos von Ischtars Abstieg nach dem Tod von Ischtars Geliebtem Tammuz entstand und dass Ischtar in die Unterwelt gegangen war, um ihn zu retten. Die Entdeckung eines entsprechenden Mythos über Inanna, das sumerische Gegenstück zu Ishtar, hat jedoch etwas Licht auf den Mythos von Ishtars Abstammung geworfen, einschließlich seiner etwas rätselhaften Schlusszeilen. In der sumerischen Version der Geschichte kann Inanna nur dann aus der Unterwelt zurückkehren, wenn jemand anderes als ihr Ersatz dorthin gebracht wird. Um dies sicherzustellen, folgt ihr eine Horde Galla-Dämonen aus der Unterwelt.
Doch jedes Mal, wenn Inanna jemandem begegnet, erkennt sie, dass er ihr Freund ist, und lässt ihn frei. Als sie schließlich ihr Zuhause erreicht, findet sie ihren Ehemann Dumuzid, das sumerische Äquivalent von Tammuz, auf seinem Thron sitzend vor, ganz und gar nicht betrübt über ihren Tod. Wütend lässt Inanna zu, dass die Dämonen Dumuzid als ihren Ersatz zurück in die Unterwelt bringen. Dumuzids Schwester Geshtinanna ist von Trauer geplagt und meldet sich freiwillig, um ein halbes Jahr in der Unterwelt zu verbringen. Während dieser Zeit kann Dumuzid freikommen. Der Ischtar-Mythos hatte vermutlich ein vergleichbares Ende, da Belili das babylonische Äquivalent von Geshtinanna war.
Das Gilgamesch-Epos enthält eine Episode mit Ishtar, in der sie als Femme Fatale dargestellt wird, die gleichzeitig gereizt, schlecht gelaunt und verwöhnt ist. Sie bittet den Helden Gilgamesch, sie zu heiraten, aber er weigert sich und verweist auf das Schicksal, das all ihren vielen Liebhabern widerfahren ist: „Hör mir zu, während ich die Geschichte deiner Liebhaber erzähle.“ Da war Tammuz, der Liebhaber deiner Jugend, für den du Jahr für Jahr wehklagen hast. Du hast den vielfarbigen lilabrüstigen Roller geliebt, aber trotzdem hast du ihn geschlagen und ihm den Flügel gebrochen. Du hast den Löwen geliebt, der so stark war; sieben Gruben hast du für ihn gegraben, und sieben. Du hast den im Kampf prachtvollen Hengst geliebt, und für ihn hast du Peitsche, Sporen und einen Riemen angeordnet [...] Du hast den Hirten der Herde geliebt; Er hat Tag für Tag Kuchen für dich gebacken, er hat deinetwegen Kinder getötet. Du hast ihn geschlagen und in einen Wolf verwandelt; Jetzt verjagen ihn seine eigenen Hirten, seine eigenen Hunde beunruhigen seine Flanken.
Wütend über Gilgameschs Weigerung geht Ishtar in den Himmel und erzählt ihrem Vater Anu, dass Gilgamesch sie beleidigt hat. Anu fragt sie, warum sie sich bei ihm beschwert, anstatt Gilgamesch selbst zur Rede zu stellen. Ishtar verlangt von Anu, ihr den Stier des Himmels zu geben, und schwört, dass sie, wenn er ihn ihr nicht gibt, in ihren eigenen Worten „… die Tore der Hölle einbrechen und die Riegel einschlagen wird; es wird Verwirrung geben [ dh, Vermischung] von Menschen, denen oben mit denen aus den tieferen Tiefen. Ich werde die Toten erwecken, damit sie wie die Lebenden essen; und die Heerscharen der Toten werden zahlreicher sein als die Lebenden.“
Anu gibt Ishtar den Stier des Himmels und Ishtar schickt ihn, um Gilgamesch und seinen Freund Enkidu anzugreifen. Gilgamesch und Enkidu töten den Stier und opfern sein Herz dem assyrisch-babylonischen Sonnengott Schamasch. Während Gilgamesch und Enkidu ruhen, steht Ishtar auf den Mauern von Uruk und verflucht Gilgamesch. Enkidu reißt dem Stier den rechten Oberschenkel ab, wirft ihn Ishtar ins Gesicht und sagt: „Wenn ich meine Hände auf dich legen könnte, würde ich dir das antun und deine Eingeweide an deine Seite peitschen.“ (Enkidu stirbt später für diese Gottlosigkeit.) Ishtar ruft „die gekräuselten Kurtisanen, Prostituierten und Huren“ zusammen und befiehlt ihnen, um den Stier des Himmels zu trauern. Unterdessen feiert Gilgamesch die Niederlage des Himmelsstiers.
Später im Epos erzählt Utnapishtim Gilgamesch die Geschichte der großen Sintflut, die vom Gott Enlil geschickt wurde, um alles Leben auf der Erde auszulöschen, weil die stark übervölkerten Menschen zu viel Lärm machten und ihn am Schlafen hinderten. Utnapishtim erzählt, wie Ishtar zusammen mit den Anunnaki weinte und über die Zerstörung der Menschheit trauerte, als die Flut kam. Später, nachdem die Flut abgeklungen ist, bringt Utnapishtim den Göttern ein Opfer dar. Ishtar erscheint Utnapishtim mit einer Lapislazuli-Halskette mit fliegenförmigen Perlen und erzählt ihm, dass Enlil mit keinem der anderen Götter über die Flut gesprochen hat. Sie schwört ihm, dass sie niemals zulassen wird, dass Enlil eine weitere Überschwemmung verursacht, und erklärt ihre Lapislazuli-Halskette zum Zeichen ihres Eides. Ishtar lädt alle Götter außer Enlil ein, sich um die Opfergabe zu versammeln und zu genießen.
Ishtar erscheint im hethitischen Schöpfungsmythos kurzzeitig als Schwester des hethitischen Sturmgottes Teshub. Im Mythos versucht Ishtar, das Monster Ullikummi zu verführen, scheitert jedoch, weil das Monster sowohl blind als auch taub ist und sie weder sehen noch hören kann. In einem pseudepigraphischen neuassyrischen Text aus dem siebten Jahrhundert v. Chr., der jedoch behauptet, die Autobiographie von Sargon von Akkad zu sein, soll Ishtar Sargon „umgeben von einer Taubenwolke“ erschienen sein, während er als Gärtner arbeitete Akki, die Wasserschöpferin. Ishtar erklärte daraufhin Sargon zu ihrem Liebhaber und erlaubte ihm, der Herrscher von Sumer und Akkad zu werden.
Als Ishtar an Bedeutung gewann, wurden mehrere kleinere oder regionale Gottheiten in sie aufgenommen, darunter Aja (Göttin der östlichen Bergdämmerung), Anatu (eine Göttin, möglicherweise Ishtars Mutter), Anunitu (akkadische Lichtgöttin), Agasayam (Kriegsgöttin), Irnini ( Göttin der Zedernwälder in den libanesischen Bergen), Kilili oder Kulili (Symbol der begehrenswerten Frau), Sahirtu (Bote der Liebenden), Kir-gu-lu (Regenbringer) und Sarbanda (Macht der Souveränität). Aus dem Ishtar-Kult entstand der spätere Kult der phönizischen Göttin Astarte, der wiederum den Kult der griechischen Göttin Aphrodite hervorbrachte. Der Mythos von Aphrodite und Adonis leitet sich wahrscheinlich vom Mythos von Ischtar und Tammuz ab. Joseph Campbell , ein Gelehrter der vergleichenden Mythologie aus dem späten 20. Jahrhundert, setzt Ishtar, Inanna und Aphrodite gleich; Er zieht auch eine Parallele zwischen der Legende von Ischtar und Tammuz und der ägyptischen Geschichte der Göttin Isis und ihrem Sohn Horus.
Moderne Gelehrte sind nicht die Einzigen, die Ischtar mit Aphrodite in Verbindung bringen. Der griechische Historiker Herodot berichtet im fünften Jahrhundert v. Chr., dass sich der älteste Tempel der Welt für Aphrodite Ourania in der Stadt Ascalon in Syrien befunden habe. In seiner Beschreibung Griechenlands bestätigt der antike griechische Reiseschriftsteller Pausanias, der im zweiten Jahrhundert n. Chr. lebte, Herodots Bericht und behauptet, dass die „Assyrer“ die ersten Menschen waren, die Aphrodite Ourania verehrten. Die Römer identifizierten Ishtar auch mit ihrer Göttin Venus. Cicero setzt in seiner Abhandlung „Über die Natur der Götter“ Astarte, die spätere phönizische Version von Ishtar, mit Venus gleich. Der spätere Schriftsteller Hyginus erzählt von einer ansonsten unbestätigten Tradition bezüglich der Geburt der Venus und demonstriert den Synkretismus zwischen ihr und Ischtar:
„In den Euphrat soll ein Ei von wunderbarer Größe gefallen sein, das der Fisch ans Ufer rollte. Darauf saßen Tauben, und als es erhitzt wurde, schlüpfte daraus Venus, die später die syrische Göttin genannt wurde. Da sie durch eine von Jupiter gewährte Gunst die anderen an Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit übertraf, wurden die Fische in die Zahl der stars aufgenommen, und aus diesem Grund essen die Syrer weder Fische noch Tauben, da sie sie als Götter betrachten.“ In seinem Buch In den zwei Babylonien versuchte der Pseudohistoriker Alexander Hislop im 19. Jahrhundert, den Namen Ishtar mit dem Wort Ostern zu verbinden. Mainstream-Wissenschaftler haben alle wichtigen Behauptungen Hislops widerlegt.
Der Name Ostern leitet sich höchstwahrscheinlich vom Namen Ēostre ab, einer germanischen Göttin, deren germanischer Monat ihren Namen trägt (nordumbrisch: Ēosturmōnaþ; westsächsisch: Ēastermōnaþ; althochdeutsch: Ôstarmânoth). Sie wird ausschließlich von Bede in seinem Werk The Reckoning of Time aus dem 8. Jahrhundert bestätigt, in dem Bede angibt, dass während Ēosturmōnaþ (dem Äquivalent des Aprils) heidnische Angelsachsen Feste zu Ēostres Ehren abgehalten hatten, diese Tradition jedoch durch ihn ausgestorben sei Zeit, ersetzt durch den christlichen Ostermonat, eine Feier der Auferstehung Jesu. Ēostre könnte ein Reflex der proto-indogermanischen Morgengöttin *Haéusōs sein. Obwohl die Namen Ishtar und Ēostre ähnlich sind, haben sie etymologisch nichts miteinander zu tun; Der Name Ēostre leitet sich von der protoindogermanischen Wurzel *aus- ab, was „Morgendämmerung“ bedeutet. Das Wort für Ostern ist in den meisten europäischen Sprachen normalerweise eine Variante des griechischen Wortes Pascha, was „Pessach“ bedeutet. [Wikipedia].
ÜBERPRÜFEN: Inanna (oder Ishtar) ist die alte sumerische Göttin der Liebe, Sinnlichkeit, Fruchtbarkeit, Fortpflanzung und auch des Krieges. Später wurde sie von den Akkadiern und Assyrern mit der Göttin Ischtar identifiziert, außerdem mit der hethitischen Sauska, der phönizischen Astarte und der griechischen Aphrodite und vielen anderen. Sie wurde auch als heller Morgen- und Abendstern, Venus, gesehen und mit der römischen Göttin identifiziert. Inanna ist eine der Kandidaten, die als Gegenstand des Burney-Reliefs (besser bekannt als „Königin der Nacht“) genannt werden, einem Terrakotta-Relief aus der Herrschaft von Hammurabi von Babylon (1792–1750 v. Chr.), obwohl ihre Schwester Ereshkigal die wichtigste Göttin ist wahrscheinlich abgebildet.
In einigen Mythen ist sie die Tochter von Enki, dem Gott der Weisheit, des Süßwassers, der Magie und einer Reihe anderer Elemente und Aspekte des Lebens, während sie in anderen als Tochter von Nanna, dem Gott des Mondes und der Weisheit, erscheint. Als Tochter von Nanna war sie die Zwillingsschwester des Sonnengottes Utu/Shamash. Ihre Macht und Provokation sind fast immer ein bestimmendes Merkmal in allen Geschichten, die über sie erzählt werden. Durch das Werk der akkadischen Dichterin und Hohepriesterin Enheduanna (2285–2250 v. Chr.), der Tochter von Sargon von Akkad (2334–2279 v. Chr.), wurde Inanna vor allem mit Ishtar identifiziert und erlangte von einer lokalen vegetativen Gottheit des sumerischen Volkes eine herausragende Bedeutung die Königin des Himmels und die beliebteste Göttin in ganz Mesopotamien. Die Historikerin Gwendoly Leick schreibt:
„Inanna war die bedeutendste sumerische Göttin und Schutzgottheit von Uruk. Ihr Name wurde mit einem Schild geschrieben, das einen Schilfrohrstiel darstellt, der an der Spitze zu einer Schlaufe zusammengebunden ist. Dies erscheint in den allerersten schriftlichen Texten aus der Mitte des vierten Jahrtausends v. Chr. Sie wird neben Anu, Enki und Enlil auch in allen frühen Götterlisten unter den vier Hauptgottheiten erwähnt. In den königlichen Inschriften der frühen Dynastie wird Inanna oft als besondere Beschützerin der Könige erwähnt. Sargon von Akkad forderte ihre Unterstützung im Kampf und in der Politik. Es scheint, dass die Göttin im dritten Jahrtausend kriegerische Aspekte erlangte, die möglicherweise auf einen Synkretismus mit der semitischen Gottheit Ischtar zurückzuführen sind. Inannas Hauptheiligtum war das Eanna („Haus des Himmels“) in Uruk, obwohl sie in den meisten Städten Tempel oder Kapellen hatte.
Die Göttin erscheint in alten mesopotamischen Mythen, in denen sie Wissen und Kultur in die Stadt Uruk bringt. Die Göttin erscheint in vielen alten mesopotamischen Mythen, insbesondere in Inanna und dem Huluppu-Baum (ein Mythos der frühen Schöpfung), Inanna und dem Gott der Weisheit (in denen sie Wissen und Kultur in die Stadt Uruk bringt, nachdem sie die Gaben des Gottes erhalten hat). der Weisheit, Enki, während er betrunken ist), The Courtship of Inanna and Dumuzi (die Geschichte von Inannas Hochzeit mit dem Vegetationsgott) und das bekannteste Gedicht The Descent of Inanna (ca. 1900-1600 v. Chr.), in dem die Königin von Himmelsreisen in die Unterwelt.
Neben diesen Werken und kurzen Hymnen an Inanna ist sie auch durch die längeren, komplizierteren Hymnen bekannt, die Enheduanna zu Ehren ihrer persönlichen Göttin und Schutzpatronin von Uruk geschrieben hat: Inninsagurra, Ninmesarra und Inninmehusa, was übersetzt „Die Großherzige“ bedeutet „Mistress“, „The Exaltation of Inanna“ und „Goddess of the Fearsome Powers“, alles drei kraftvolle Hymnen, die Generationen von Mesopotamiern in ihrem Verständnis der Göttin beeinflussten und ihren Status von einer lokalen zu einer höchsten Gottheit erhoben. Ihr persönlicher Ehrgeiz wird in zahlreichen Werken bezeugt, in denen sie zu sehen ist. Dr. Jeremy Black schreibt:
„Sie ist gewalttätig und machthungrig und steht ihren Lieblingskönigen im Kampf zur Seite. In einem sumerischen Gedicht führt Inanna einen Feldzug gegen den Berg Egih. Ihre Reise nach Eridu, um das Meh zu erhalten, und ihr Abstieg in die Unterwelt sollen beide dazu dienen, ihre Macht zu erweitern.“ Dieser Ehrgeiz lässt sich auch an ihrer Manipulation von Gilgamesch in der Geschichte vom Huluppu-Baum erkennen: Als sie das Problem der Schädlinge, die den Baum befallen, nicht bewältigen kann und keine Hilfe bei ihrem Bruder Utu/Shamash findet, erregt sie die Aufmerksamkeit von Gilgamesch, der sich für sie um die Situation kümmert.
Dennoch sind ihre Absichten in dieser Geschichte wahr. Sie möchte den Baum nur kultivieren, um das Holz zu ernten, und kann nicht mit den ernsten und bedrohlichen Schädlingen umgehen, die ihn zu ihrem Zuhause machen. Ihre Schenkung der heiligen Trommel und der Trommelstöcke an Gilgamesch für ihre Hilfe führte schließlich dazu, dass Enkidu in die Unterwelt reiste, um sie zurückzuholen, und zu den faszinierenden Offenbarungen, die sein Geist Gilgamesch zurückbringt. Im berühmten sumerisch-babylonischen Gedicht Das Gilgamesch-Epos (ca. 2700 - 1400 v. Chr.) erscheint Inanna als Ischtar und in der phönizischen Mythologie als Astarte.
Im griechischen Mythos „Das Urteil des Paris“, aber auch in anderen Erzählungen der antiken Griechen, wird die Göttin Aphrodite aufgrund ihrer großen Schönheit und Sinnlichkeit traditionell mit Inanna in Verbindung gebracht. Inanna wird immer als junge Frau dargestellt, niemals als Mutter oder treue Ehefrau, die sich ihrer weiblichen Kraft voll bewusst ist und sich dem Leben mutig stellt, ohne Angst davor zu haben, wie sie von anderen, insbesondere von Männern, wahrgenommen wird. Im Gilgamesch-Epos wird sie als Ishtar als promiskuitiv, eifersüchtig und boshaft angesehen. Als sie versucht, Gilgamesch zu verführen, zählt er ihr viele andere Liebhaber auf, die allesamt ein böses Ende durch sie erlebt haben.
Wütend über seine Ablehnung schickt sie den Ehemann ihrer Schwester Ereshkigal, Gugulana (den Stier des Himmels), um Gilgameschs Reich zu zerstören. Gugulana wird daraufhin von Enkidu, dem besten Freund und Mitstreiter Gilgameschs, getötet, wofür er von den Göttern zum Tode verurteilt wird. Enkidus Tod ist der Auslöser für Gilgameschs berühmte Suche nach dem Sinn des Lebens. Inanna spielt also eine zentrale Rolle in der Geschichte eines der größten antiken Epen. Sie wird oft in Begleitung eines Löwen dargestellt, was Mut symbolisiert, und manchmal reitet sie sogar auf dem Löwen als Zeichen ihrer Überlegenheit über den „König der Tiere“.
In ihrem Aspekt als Kriegsgöttin wird Inanna in der Rüstung eines Mannes und in Kampfkleidung dargestellt (Statuen zeigen sie häufig mit Köcher und Bogen bewaffnet) und wird daher auch mit der griechischen Göttin Athene Nike identifiziert. Darüber hinaus wurde sie mit der Göttin Demeter als Fruchtbarkeitsgottheit und mit Persephone als sterbender und wiederauferstehender Gottheit in Verbindung gebracht, zweifellos ein Überbleibsel ihrer ursprünglichen Inkarnation als ländliche Göttin der Landwirtschaft. Obwohl einige Autoren etwas anderes behauptet haben, wurde Inanna nie als Muttergöttin angesehen, wie dies bei anderen Gottheiten wie Ninhursag der Fall war. Dr. Jeremy Black bemerkt:
„Ein Aspekt von [Inannas Persönlichkeit] ist der einer Göttin der Liebe und des Sexualverhaltens, insbesondere aber verbunden mit außerehelichem Sex und – in einer noch nicht vollständig erforschten Weise – mit Prostitution.“ Inanna ist weder eine Göttin der Ehe noch eine Muttergöttin. Die sogenannte Heilige Ehe, an der sie teilnimmt, hat keinerlei moralische Implikationen für menschliche Ehen.“ Vielmehr ist Inanna eine unabhängige Frau, die tut, was sie will, oft ohne Rücksicht auf Konsequenzen, und entweder manipuliert, droht oder es versucht andere dazu verführen, die Schwierigkeiten, die ihr Verhalten verursacht, zu beheben. Es gibt keine Gedichte, Erzählungen oder Legenden, die sie in irgendeiner Weise anders darstellen, und keines, das sie in der Rolle der Muttergöttin darstellt.
Im mesopotamischen Pantheon variiert die Geneologie von Inanna je nach der Ära des Mythos und der erzählten Geschichte. Sie ist die Tochter des höchsten Gottes Anu, wird aber auch als Tochter des Mondgottes Nanna und seiner Gemahlin Ningal dargestellt. Alternativ ist sie die Tochter des Gottes der Weisheit Enki und die Schwester von Ereshkigal (Göttin der Unterwelt), Zwillingsschwester des Sonnengottes Utu/Shamash und Schwester von Ishkur (auch bekannt als Adad), dem Gott der Stürme. Sie wird manchmal auch als Tochter des höchsten Gottes der Luft, Enlil, bezeichnet.
Ihr Ehemann Dumuzi – der im Gedicht „Der Abstieg von Inanna“ unter ihren überstürzten Entscheidungen leidet – verwandelt sich mit der Zeit in den sterbenden und wiederauflebenden Gott Tammuz, und jedes Jahr zur Herbst-Tagundnachtgleiche feierten die Menschen die heiligen Hochzeitsriten von Inanna und Dumuzi (Ishtar und Tammuz), als er aus der Unterwelt zurückkehrte, um sich erneut mit ihr zu paaren und so das Land zum Leben zu erwecken. Die heilige Hochzeit von Inanna und Dumuzi war für die Fruchtbarkeit des Landes von zentraler Bedeutung und wurde bei wichtigen Festen (wie dem Akitu-Fest in Babylon) nachgestellt, indem der König und eine Priesterin Geschlechtsverkehr hatten oder sich vielleicht nur symbolisch paarten Art Pantomime.
Ihr Tempel in Uruk war ihr zentrales Kultzentrum, aber in ganz Mesopotamien gab es zahlreiche Tempel und Schreine, und möglicherweise wurden heilige Prostituierte beiderlei Geschlechts eingesetzt, um die Fruchtbarkeit der Erde und den anhaltenden Wohlstand der Gemeinden sicherzustellen. Inanna blieb eine mächtige und beliebte Göttin, bis das Ansehen weiblicher Gottheiten während der Herrschaft von Hammurabi sank, was laut dem Gelehrten Samuel Noah Kramer mit dem Verlust von Status und Rechten der Frauen in der Gesellschaft zusammenfiel. Dennoch wurde sie als Ishtar der Assyrer weiterhin weithin verehrt und inspirierte die Visionen ähnlicher Gottheiten in anderen Kulturen des Nahen Ostens und darüber hinaus.
Inanna gehört zu den ältesten Gottheiten, deren Namen im antiken Sumer verzeichnet sind. Sie zählt zu den ersten sieben göttlichen Kräften: Anu, Enlil, Enki, Ninhursag, Nanna, Utu und Inanna. Diese sieben würden die Grundlage für viele Merkmale der folgenden Götter bilden. Im Fall von Inanna würde sie, wie oben erwähnt, ähnliche Gottheiten in vielen anderen Kulturen inspirieren. Inanna ist eine völlig andere Persönlichkeit als die traditionelle Muttergöttin (wie in Ninhursag dargestellt) und eine freche, unabhängige junge Frau; impulsiv und doch berechnend, freundlich und gleichzeitig rücksichtslos gegenüber den Gefühlen oder dem Eigentum anderer oder sogar ihrem Leben. Jeremy Black schreibt:
„Die Tatsache, dass Inanna in keiner Tradition einen ständigen männlichen Ehepartner hat, hängt eng mit ihrer Rolle als Göttin der sexuellen Liebe zusammen. Sogar Dumuzi, die oft als ihre „Geliebte“ beschrieben wird, hat eine sehr zwiespältige Beziehung zu ihr und sie ist letztendlich für seinen Tod verantwortlich.“ Die Tatsache, dass die Sumerer sich eine solche Göttin vorstellen konnten, spricht für ihren kulturellen Wert und ihr Verständnis von Weiblichkeit . In der sumerischen Kultur galten Frauen als gleichberechtigt und selbst ein oberflächlicher Blick auf ihr Pantheon zeigt eine Reihe bedeutender weiblicher Gottheiten wie Gula, Ninhursag, Nisaba und Ninkasi und viele andere.
Mit der Zeit verloren diese Göttinnen jedoch ihren Status an männliche Gottheiten. Unter der Herrschaft des Amoriterkönigs Hammurabi von Babylon (1792–1750 v. Chr.) wurden Göttinnen zunehmend durch Götter ersetzt. Inanna behielt ihre Position und ihr Ansehen durch ihre Adoption durch das assyrische und neoassyrische Reich als Ishtar, Göttin des Krieges und der Sexualität, aber vielen anderen erging es nicht so gut. Nisaba, früher die Schreiberin der Götter und Schutzpatronin des geschriebenen Wortes, wurde unter Hammurabis Herrschaft dem Gott Nabu gleichgestellt, und dies war das Schicksal vieler anderer.
Inanna hielt es jedoch aus, weil sie so zugänglich und erkennbar war. Sowohl Frauen als auch Männer konnten sich mit dieser Göttin identifizieren und es war kein Zufall, dass beide Geschlechter ihr als Priester, Tempeldiener und heilige Prostituierte dienten. Inanna weckte bei den Menschen den Wunsch, ihr zu dienen, weil sie war, nicht wegen dem, was sie zu bieten hatte, und ihre Anhänger blieben ihr treu, lange nachdem die Anbetung in ihren Tempeln aufgehört hatte. Sie war eng mit dem Morgen- und Abendstern verbunden und ist es auch heute noch – auch wenn sich nur wenige an ihren Namen erinnern. [Enzyklopädie der antiken Geschichte].
ÜBERPRÜFEN: Liebe ist ein Schlachtfeld: Die Legende von Ishtar, der ersten Göttin der Liebe und des Krieges. Wie Sänger Pat Benatar einmal bemerkte, ist Liebe ein Schlachtfeld. Eine solche Verwendung militärischer Worte zum Ausdruck intimer, liebevoller Gefühle hängt wahrscheinlich mit der Fähigkeit der Liebe zusammen, zu verletzen und zu verwirren. So war es auch mit der ersten Liebes- und Kriegsgöttin der Welt, Ischtar, und ihrem Geliebten Tammuz. Im alten Mesopotamien – das ungefähr dem heutigen Irak, Teilen Irans, Syriens, Kuwaits und der Türkei entspricht – war die Liebe eine mächtige Kraft, die in der Lage war, die irdische Ordnung auf den Kopf zu stellen und drastische Statusänderungen herbeizuführen.
Von Aphrodite bis Wonder Woman sind wir nach wie vor von mächtigen weiblichen Protagonistinnen fasziniert, ein Interesse, das bis in unsere frühesten schriftlichen Aufzeichnungen zurückreicht. Ishtar (das Wort stammt aus der akkadischen Sprache; sie war auf Sumerisch als Inanna bekannt) war die erste Gottheit, für die wir schriftliche Beweise haben. Sie war eng mit der romantischen Liebe verbunden, aber auch mit der familiären Liebe, den liebevollen Bindungen zwischen Gemeinschaften und der sexuellen Liebe. Sie war auch eine Kriegergottheit mit einer starken Fähigkeit zur Rache, wie ihr Geliebter herausfinden sollte. Diese scheinbar gegensätzlichen Persönlichkeiten haben sowohl in der Antike als auch in der Moderne für Stirnrunzeln bei Gelehrten gesorgt. Ishtar ist eine Liebesgottheit, die auf dem Schlachtfeld furchterregend ist. Ihre Schönheit ist Gegenstand von Liebesgedichten, und ihre Wut wird mit einem zerstörerischen Sturm verglichen. Aber in ihrer Fähigkeit, Schicksale und Vermögen zu gestalten, sind das zwei Seiten derselben Medaille.
Die frühesten Gedichte an Ishtar wurden von Enheduanna geschrieben – dem weltweit ersten individuell identifizierten Autor. Enheduanna (ca. 2300 v. Chr.) gilt allgemein als eine historische Persönlichkeit, die in Ur, einem der ältesten städtischen Zentren der Welt, lebte. Sie war eine Priesterin des Mondgottes und die Tochter von Sargon von Akkad („Sargon der Große“), dem ersten Herrscher, der Nord- und Südmesopotamien vereinte und das mächtige akkadische Reich gründete. Die Quellen für Enheduannas Leben und Karriere sind historischer, literarischer und archäologischer Natur: Sie gab ein Alabasterrelief in Auftrag, die Scheibe von Enheduanna, auf der ihre Widmung eingraviert ist.
In ihren Gedichten offenbart Enheduanna die Vielfalt von Ishtar, einschließlich ihrer überragenden Fähigkeit für bewaffnete Konflikte und ihrer Fähigkeit, abrupte Veränderungen in Status und Vermögen herbeizuführen. Diese Fähigkeit passte gut zu einer Göttin der Liebe und des Krieges – beides Bereiche, in denen es zu schnellen Rückschlägen kommen kann, die den Stand der Dinge völlig verändern. Auf dem Schlachtfeld sicherte die Fähigkeit der Göttin, Schicksale zu bestimmen, den Sieg. In der Liebesmagie könnte Ishtars Macht romantische Schicksale verändern. In alten Liebeszaubern wurde ihr Einfluss genutzt, um das Herz (und andere Körperteile) eines begehrten Liebhabers zu gewinnen oder sogar zu erobern.
Ishtar wird (von ihr selbst in Liebesgedichten und von anderen) als schöne, junge Frau beschrieben. Ihr Liebhaber Tammuz lobt sie für die Schönheit ihrer Augen, eine scheinbar zeitlose Form der Schmeichelei, deren literarische Geschichte bis etwa 2100 v. Chr. zurückreicht. Ishtar und Tammuz sind die Protagonisten einer der ersten Liebesgeschichten der Welt. In Liebesgedichten, die von ihrer Liebesbeziehung erzählen, führen die beiden eine sehr liebevolle Beziehung. Doch wie viele große Liebesgeschichten endet ihre Verbindung tragisch.
Der berühmteste Bericht über diesen Mythos ist Ischtars Abstieg in die Unterwelt, Autor unbekannt. Diese alte Erzählung, die in sumerischen und akkadischen Versionen (beide in Keilschrift verfasst) überliefert ist, wurde erst im 19. Jahrhundert entziffert. Es beginnt mit Ishtars Entscheidung, das Reich ihrer Schwester Ereshkigal, der Königin der Unterwelt, zu besuchen. Angeblich besucht sie ihre Schwester, um den Tod ihres Schwagers zu betrauern, möglicherweise des Himmelsstiers, der im Gilgamesch-Epos erscheint. Aber die anderen Götter in der Geschichte betrachten den Schritt als einen Versuch einer feindlichen Übernahme. Ishtar war dafür bekannt, äußerst ehrgeizig zu sein; in einem anderen Mythos stürmt sie den Himmel und inszeniert einen göttlichen Coup.
Alle Fragen zu Ishtars Motiven werden durch die Beschreibung ihrer Vorbereitung auf ihre Reise geklärt. Sie trägt sorgfältig Make-up und Schmuck auf und hüllt sich in wunderschöne Kleidung. Ishtar wird oft beschrieben, wie sie Kosmetika aufträgt und ihr Aussehen verbessert, bevor sie sich auf den Weg zum Kampf macht oder bevor sie einen Liebhaber trifft. So wie ein männlicher Krieger vor einem Kampf einen Brustpanzer anlegt, so umrandet Ishtar ihre Augen mit Wimperntusche. Sie ist die echte Power-Dresserin: Ihre Schönheit und die Wahl ihrer Kleidung betonen ihre Potenz.
Als nächstes weist die Göttin in einer humorvollen Szene voller Ironie ihre treue Dienerin Ninshubur an, wie sie sich verhalten soll, wenn Ishtar in der Unterwelt gefangen ist. Zuerst muss Ninshubur sich in die richtige Trauerkleidung, wie zum Beispiel einen Sack, kleiden und ein zerzaustes Erscheinungsbild schaffen. Dann muss sie zu den Tempeln der großen Götter gehen und um Hilfe bitten, um ihre Herrin zu retten. Ishtars Anweisungen, dass ihre Dienerin angemessen düstere Trauerkleidung tragen soll, stehen in starkem Kontrast zu ihrer eigenen auffälligen Kleidung. Doch als Ereshkigal erfährt, dass Ishtar so gut gekleidet ist, wird ihr klar, dass sie gekommen ist, um die Unterwelt zu erobern. Deshalb schmiedet sie einen Plan, um Ishtar buchstäblich ihrer Macht zu berauben.
Bei Ereshkigals Haus angekommen, steigt Ishtar durch die sieben Tore der Unterwelt hinab. An jedem Tor wird sie angewiesen, ein Kleidungsstück auszuziehen. Als sie vor ihrer Schwester ankommt, ist Ishtar nackt und Ereshkigal tötet sie sofort. Ihr Tod hat schreckliche Folgen und beinhaltet das Ende aller irdischen sexuellen Intimität und Fruchtbarkeit. Auf Anraten von Ishtars Dienerin schmiedet Ea, der Gott der Weisheit, einen Plan, um Ishtar wiederzubeleben und in die Oberwelt zurückzubringen. Sein Plan gelingt, doch es gibt ein altes mesopotamischen Sprichwort: „Niemand kommt unbemerkt aus der Unterwelt zurück.“
Nachdem in der Unterwelt ein Raum geschaffen worden war, glaubte man, dass dieser nicht mehr leer bleiben dürfe. Ishtar wird angewiesen, mit einer Dämonenbande in die Oberwelt aufzusteigen und ihren eigenen Ersatz zu finden. In der Welt oben sieht Ishtar Tammuz, der königlich gekleidet auf einem Thron sitzt und scheinbar unberührt von ihrem Tod ist. Wütend befiehlt sie den Dämonen, ihn mitzunehmen. Ishtars Rolle beim Tod ihres Mannes hat ihr den Ruf eingebracht, etwas wankelmütig zu sein. Diese Einschätzung erfasst jedoch nicht die Komplexität der Rolle der Göttin. Ishtar wird im Mythos ihrer Abstammung und anderswo als zu großer Treue fähig dargestellt: Anstatt wankelmütig zu sein, zeigt ihre Rolle beim Tod ihres Mannes ihre rachsüchtige Natur.
Frauen und Rache erwiesen sich in den Mythen des antiken Griechenlands und Roms als beliebte Kombination, wo mächtige Frauen wie Elektra, Klytämnestra und Medea schreckliche Folgen für diejenigen hatten, die ihrer Meinung nach ihnen Unrecht getan hatten. Dieses Thema fasziniert das Publikum bis heute. Das Konzept wird durch die oft fälschlicherweise Shakespeare zugeschriebene Zeile aus William Congreves „Die trauernde Braut“ auf den Punkt gebracht: „Der Himmel hat keine Wut wie die Liebe, die sich in Hass verwandelt, und die Hölle keine Wut wie eine verachtete Frau.“
Bevor sie sieht, wie sich ihr Mann nach ihrem Tod entspannt, trifft Ishtar zunächst auf ihre Magd Ninshubur und ihre beiden Söhne. Ein Sohn wird als Manikürist und Friseur der Göttin beschrieben, der andere ist ein Krieger. Alle drei werden von der Göttin aufgrund ihres treuen Dienstes und ihrer offensichtlichen Trauerbekundungen über Ishtars Tod verschont – sie werden alle in Lumpen gekleidet im Staub liegend beschrieben. Dem fleißigen Verhalten von Ischtars Dienern stehen die Handlungen von Tammuz gegenüber, ein vernichtender Kontrast, der zeigt, dass es ihm an angemessenem Trauerverhalten mangelt. Loyalität ist das Hauptkriterium, anhand dessen Ishtar entscheidet, wer sie in der Unterwelt ersetzen wird. Das macht sie kaum treulos.
Ishtars Streben nach Rache in antiken Mythen ist eine Erweiterung ihrer engen Verbindung zur Rechtsprechung und zur Aufrechterhaltung der universellen Ordnung. Liebe und Krieg sind beides Kräfte mit dem Potenzial, Chaos und Verwirrung zu schaffen, und die mit ihnen verbundene Gottheit musste sowohl in der Lage sein, die Ordnung wiederherzustellen als auch sie zu stören. Dennoch konnte die Liebe in Mesopotamien den Tod überleben. Auch für Tammuz war Liebe Erlösung und Schutz: Die treue Liebe seiner Schwester Geshtinanna ermöglichte ihm schließlich die Rückkehr aus der Unterwelt. Wie man sagt, stirbt die Liebe nie – aber in den seltenen Fällen, in denen sie für einen Moment vergeht, ist es am besten, angemessen zu trauern.
Ishtar war eine der beliebtesten Gottheiten des mesopotamischen Pantheons, doch in der heutigen Zeit ist sie fast völlig anonym geblieben. Ishtars Vermächtnis zeigt sich am deutlichsten in ihrem Einfluss auf spätere kulturelle Archetypen, wobei ihr Bild zur Entwicklung der berühmtesten Liebesgöttin von allen, Aphrodite, beitrug. Ishtar taucht in der Science-Fiction auf, insbesondere als schöne, aber selbstzerstörerische Stripperin in Neil Gaimans Comic „The Sandman: Brief Lives“. Gaimans außergewöhnliche Beherrschung der mesopotamischen Mythologie lässt darauf schließen, dass die „Entblößung“ von Ishtar möglicherweise eine Anspielung auf die alte Erzähltradition ihrer Abstammung darstellt.
Sie wird in dem Film von 1987, der ihren Namen trägt (schlecht aufgenommen, aber mittlerweile so etwas wie ein Kultklassiker), nicht direkt erwähnt, obwohl die weibliche Hauptfigur Shirra einige Ähnlichkeiten mit der Göttin aufweist. Der Abstieg von Inanna in die Unterwelt: Ein 5.500 Jahre altes literarisches Meisterwerk. Das Ischtar-Tor und die Gottheiten Babylons. Die sumerischen Sieben: Die höchsten Götter im sumerischen Pantheon. In der Tradition der Graphic Novels wird Aphrodite zugeschrieben, dass sie das Bild von Wonder Woman geprägt hat, und Aphrodites eigenes Bild wurde von Ishtar beeinflusst. Dieser Zusammenhang könnte teilweise die faszinierenden Ähnlichkeiten zwischen Ishtar und dem modernen Superhelden erklären: Beide Figuren werden als Krieger dargestellt, die mit Armbändern und einer Tiara das Schlachtfeld zieren, eine Seilwaffe schwingen und Liebe, Loyalität und einen leidenschaftlichen Einsatz für Gerechtigkeit demonstrieren.
Es gibt faszinierende Ähnlichkeiten zwischen Ishtar und Wonder Woman. Wie andere Liebesgöttinnen wird auch Ishtar in alten Sexual- und Fruchtbarkeitsritualen in Verbindung gebracht, obwohl die Beweise dafür umstritten sind und häufig die vielen anderen faszinierenden Eigenschaften der Gottheit in den Schatten stellen. Die Erkundung des Bildes der ersten Göttin der Welt bietet einen Einblick in die mesopotamische Kultur und die anhaltende Kraft der Liebe im Laufe der Jahrhunderte. Heutzutage heißt es, die Liebe könne alles besiegen, und in der Antike tat Ishtar genau das. [Alte Ursprünge].
ÜBERPRÜFEN: In der mesopotamischen Mythologie war Ereshkigal („Königin der Großen Erde“) die Göttin von Kur, dem Land der Toten oder der Unterwelt in der sumerischen Mythologie. In späteren ostsemitischen Mythen soll sie zusammen mit ihrem Ehemann Nergal Irkalla regiert haben. Manchmal wird ihr Name als Irkalla angegeben, ähnlich wie der Name Hades in der griechischen Mythologie sowohl für die Unterwelt als auch für ihren Herrscher verwendet wurde, und manchmal wird er als Ninkigal („Große Dame der Erde“ oder „Herrin der Großen Erde“) angegeben "). In sumerischen Mythen war Ereshkigal die einzige, die in ihrem Königreich urteilen und Gesetze erlassen konnte. Der ihr gewidmete Haupttempel befand sich in Kutha.
In dem alten sumerischen Gedicht „Inannas Abstieg in die Unterwelt“ wird Ereshkigal als Inannas ältere Schwester beschrieben. Die beiden wichtigsten Mythen rund um Ereshkigal sind die Geschichte von Inannas Abstieg in die Unterwelt und die Geschichte von Ereshkigals Hochzeit mit dem Gott Nergal. In der antiken sumerischen Mythologie ist Ereshkigal die Königin der Unterwelt. Sie ist die ältere Schwester der Göttin Inanna. Inanna und Ereshkigal repräsentieren polare Gegensätze. Inanna ist die Königin des Himmels, aber Ereshkigal ist die Königin von Irkalla. Ereshkigal spielt in zwei besonderen Mythen eine sehr herausragende und wichtige Rolle.
Der erste Mythos über Ereshkigal wird im alten sumerischen Epos „Inannas Abstieg in die Unterwelt“ beschrieben. In dem Gedicht steigt die Göttin Inanna in die Unterwelt hinab, offenbar um dort ihre Kräfte zu erweitern. Ereshkigal wird als Inannas ältere Schwester beschrieben. Als Neti, der Torwächter der Unterwelt, Ereshkigal darüber informiert, dass Inanna vor den Toren der Unterwelt steht und Einlass verlangt, antwortet Ereshkigal, indem er Neti befiehlt, die sieben Tore der Unterwelt zu verriegeln und jedes Tor einzeln zu öffnen, aber erst danach Inanna hat ein Kleidungsstück entfernt.
Inanna geht durch jedes Tor und legt an jedem Tor ein Kleidungsstück ab. Nachdem sie schließlich alle sieben Tore passiert hat, steht sie nackt und machtlos vor dem Thron von Ereshkigal. Die sieben Richter der Unterwelt beurteilen Inanna und erklären sie für schuldig. Inanna wird tot geschlagen und ihre tote Leiche wird in der Unterwelt an einen Haken gehängt, damit jeder sie sehen kann. Inannas Minister Ninshubur fleht jedoch Enki an und Enki willigt ein, Inanna aus der Unterwelt zu retten.
Enki schickt zwei geschlechtslose Wesen in die Unterwelt, um Inanna mit der Nahrung und dem Wasser des Lebens wiederzubeleben. Die geschlechtslosen Wesen geleiten Inanna aus der Unterwelt hinauf, doch eine Horde wütender Dämonen folgt Inanna zurück aus der Unterwelt und verlangt, jemand anderen als Inannas Ersatz in die Unterwelt zu bringen. Als Inanna herausfindet, dass ihr Ehemann Dumuzid ihren Tod nicht betrauert hat, wird sie wütend auf ihn und befiehlt den Dämonen, Dumuzid als ihren Ersatz zu nehmen.
Der andere Mythos ist die Geschichte von Nergal, dem Pestgott. Einmal veranstalteten die Götter ein Bankett, zu dem Ereshkigal als Königin der Unterwelt nicht kommen konnte. Sie luden sie ein, einen Boten zu schicken, und sie schickte an ihrer Stelle ihren Wesir Namtar. Er wurde von allen gut behandelt, mit der Ausnahme, dass er von Nergal nicht respektiert wurde. Infolgedessen wurde Nergal in das von der Göttin kontrollierte Königreich verbannt. Zu diesem Zeitpunkt gibt es unterschiedliche Versionen, aber alle führen dazu, dass er ihr Ehemann wird. In späteren Überlieferungen soll Nergal der victor gewesen sein, der sie zur Frau nahm und selbst über das Land herrschte.
Es wird vermutet, dass die Geschichte von Inannas Abstieg erzählt wird, um die Möglichkeit einer Flucht aus der Unterwelt zu veranschaulichen, während der Nergal-Mythos die Existenz zweier Herrscher der Unterwelt in Einklang bringen soll: einer Göttin und eines Gottes. Der Zusatz Nergal stellt die harmonisierende Tendenz dar, Ereshkigal als Königin der Unterwelt mit dem Gott zu vereinen, der als Gott des Krieges und der Pest den Lebenden den Tod bringt und so derjenige wird, der über die Toten herrscht. In einigen Versionen der Mythen regiert Ereshkigal allein über die Unterwelt, in anderen Versionen der Mythen regiert Ereshkigal jedoch zusammen mit einem ihr untergeordneten Ehemann namens Gugalana.
In seinem Buch „Sumerian Mythology: A Study of Spiritual and Literary Achievement in the Third Millennium BC“ schreibt der renommierte Gelehrte des antiken Sumer, Samuel Noah Kramer , dass laut der einleitenden Passage des antiken sumerischen Epos „Gilgamesch, Enkidu und die Unterwelt“ wurde Ereshkigal gewaltsam entführt, von den Kur in die Unterwelt gebracht und musste gegen ihren Willen Königin der Unterwelt werden. Um die Entführung von Ereshkigal zu rächen, machte sich Enki, der Gott des Wassers, in einem Boot auf den Weg, um die Kur zu töten.
Der Kur verteidigt sich, indem er Enki mit Steinen unterschiedlicher Größe bewirft und die Wellen unter Enkis Boot schickt, um Enki anzugreifen. Das Gedicht erklärt nie wirklich, wer der endgültige victor der Schlacht ist, es wird jedoch angedeutet, dass Enki gewinnt. Samuel Noah Kramer bezieht diesen Mythos auf den antiken griechischen Mythos von der Vergewaltigung Persephones und behauptet, dass die griechische Geschichte wahrscheinlich von der antiken sumerischen Geschichte abgeleitet sei. In der sumerischen Mythologie ist Ereshkigal die Mutter der Göttin Nungal. Ihr Sohn mit Enlil ist der Gott Namtar. Mit Gugalana ist ihr Sohn Ninazu.
In späteren Zeiten scheinen die Griechen und Römer Ereshkigal mit ihrer eigenen Göttin Hekate synchronisiert zu haben. In der Überschrift eines Zauberspruchs im Michigan Magical Papyrus, der auf das späte dritte oder frühe vierte Jahrhundert n. Chr. datiert wird, wird Hekate als „Hecate Ereschkigal“ bezeichnet und mit magischen Worten und Gesten angerufen, um die Angst des Zauberers vor Bestrafung zu lindern im Jenseits. [Wikipedia].
ÜBERPRÜFEN: Ereshkigal (auch bekannt als Irkalla und Allatu) ist die mesopotamische Königin der Toten, die die Unterwelt regiert. Ihr Name bedeutet übersetzt „Königin der Großen Tiefe“ oder „Herrin des Großen Ortes“. Das Wort „groß“ sollte als „riesig“ und nicht als „außergewöhnlich“ verstanden werden und bezog sich auf das Land der Toten, das vermutlich unterhalb der Berge des Sonnenuntergangs im Westen lag und als Kurnugia („das Land ohne Wiederkehr“) bekannt war '). Kurnugia war ein riesiges Reich der Düsterkeit unter der Erde, wo die Seelen der Toten aus schlammigen Pfützen tranken und Staub fraßen.
Ereshkigal herrschte über diese Seelen von ihrem Palast Ganzir aus, der sich am Eingang zur Unterwelt befand und von sieben Toren bewacht wurde, die von ihrer treuen Dienerin Neti bewacht wurden. Sie regierte ihr Reich allein, bis der Kriegsgott Nergal (auch bekannt als Erra) für sechs Monate im Jahr ihr Gemahl und Mitherrscher wurde. Erishkigal ist die ältere Schwester der Göttin Inanna und vor allem für ihre Rolle in dem berühmten sumerischen Gedicht „Der Abstieg der Inanna“ (ca. 1900–1600 v. Chr.) bekannt.
Ihr erster Ehemann (und Vater des Gottes Ninazu) war der große Himmelsstier Gugalana, der im Gilgamesch-Epos vom Helden Enkidu getötet wurde. Ihr zweiter Ehemann (oder Gemahl) war der Gott Enlil, mit dem sie einen Sohn, Namtar, gebar, und von einem anderen Gemahl wurde ihre Tochter Nungal (auch bekannt als Manungal) gezeugt, eine Unterweltgottheit, die die Bösen bestrafte und mit Heilung und Vergeltung in Verbindung gebracht wurde . Ihr vierter Gefährte war Nergal, der einzige Gefährte, der sich bereit erklärte, mit ihr im Reich der Toten zu bleiben.
Es gibt keine bekannte Ikonographie für Ereshkigal oder zumindest keine allgemein anerkannte. „Das Burney-Relief“ (auch bekannt als „Die Königin der Nacht“ aus der Regierungszeit Hammurabis von 1792–1750 v. Chr.) wird oft als Darstellung von Ereshkigal interpretiert. Das Terrakotta-Relief zeigt eine nackte Frau mit nach unten gerichteten Flügeln, die auf dem Rücken zweier Löwen steht und von Eulen flankiert wird. Sie hält Symbole der Macht und unter den Löwen sind Bilder von Bergen zu sehen. Diese Ikonographie deutet stark auf eine Darstellung von Ereshkigal hin, aber Gelehrte haben das Werk auch als eine Hommage an Inanna oder den Dämon Lilith interpretiert.
Obwohl das Relief höchstwahrscheinlich Ereshkigal darstellt und es andere ähnliche Reliefs derselben Figur mit unterschiedlichen Details gibt, wäre es nicht verwunderlich, wenn in der Kunst nur wenige Bilder von ihr zu finden wären. Ereshkigal war die am meisten gefürchtete Gottheit im mesopotamischen Pantheon, weil sie das endgültige Ziel darstellte, von dem es kein Zurück mehr gab. Im mesopotamischen Glauben bedeutete die Schaffung eines Bildes von jemandem oder etwas, die Aufmerksamkeit des Motivs zu erregen. Man ging beispielsweise davon aus, dass Götterstatuen die Götter selbst beherbergen und Bilder auf Zylindersiegeln von Menschen angeblich amulierende Eigenschaften haben.
Eine Statue oder ein Bild von Ereshkigal hätte also die Aufmerksamkeit der Königin der Toten auf den Schöpfer oder Besitzer gelenkt, und das war alles andere als wünschenswert. Ereshkigal wird erstmals im sumerischen Gedicht „Der Tod von Ur-Nammu“ erwähnt, das auf die Herrschaft von Schulgi von Ur (2029–1982 v. Chr.) datiert. Sie war jedoch zweifellos schon früher bekannt, und zwar höchstwahrscheinlich zur Zeit des Akkadischen Reiches (2334–2218 v. Chr.). Ihr akkadischer Name, Allatu, kann auf Fragmenten aus der Zeit vor Schulgis Herrschaft erwähnt werden. Zur Zeit der altbabylonischen Zeit (ca. 2000-1600 v. Chr.) galt Ereshkigal weithin als Königin der Toten, was die Behauptung stützt, dass das Relief der Königin der Nacht aus Hammurabis Herrschaft sie darstellt.
Obwohl Göttinnen später in der mesopotamischen Geschichte ihren Status verloren, zeigen erste Beweise eindeutig, dass die mächtigsten Gottheiten einst weiblich waren. Inanna (später Ishtar der Assyrer) gehörte zu den beliebtesten Gottheiten und könnte ähnliche Göttinnen in vielen anderen Kulturen inspiriert haben, darunter Sauska der Hethiter, Astarte der Phönizier, Aphrodite der Griechen, Venus der Römer und vielleicht sogar Isis die Ägypter. Die Unterwelt in all diesen anderen Kulturen wurde jedoch von einem Gott regiert, und Ereshkigal ist einzigartig, da sie die einzige weibliche Gottheit war, die diese Position innehatte, selbst nachdem Götter die Göttinnen verdrängt hatten und ihr Nergal als Gemahlin gegeben wurde.
Obwohl Ereshkigal gefürchtet war, genoss man auch großen Respekt. Der Abstieg von Inanna wurde in der heutigen Zeit weithin – und fälschlicherweise – als symbolische Reise einer Frau interpretiert, die zu ihrem „wahren Selbst“ wird. Geschriebene Werke dürfen nur in angemessener Weise interpretiert werden, soweit diese Interpretation durch den Text gestützt werden kann. „The Descent of Inanna“ eignet sich sicherlich für eine Jungsche Interpretation einer Reise zur Ganzheit, bei der man sich mit der eigenen dunkleren Hälfte konfrontiert, aber das wäre weder die ursprüngliche Bedeutung des Gedichts gewesen, noch wird diese Interpretation durch das Werk selbst gestützt. Weit davon entfernt, Inanna zu loben oder sie als heroischen Archetyp darzustellen, zeigt das Gedicht sie als egoistisch und eigennützig und endet darüber hinaus mit einem Lob für Ereshkigal, nicht für Inanna.
Inanna/Ishtar wird in der mesopotamischen Literatur häufig als eine Frau dargestellt, die größtenteils nur an sich selbst und ihre eigenen Wünsche denkt, oft auf Kosten anderer. Im Gilgamesch-Epos werden ihre sexuellen Annäherungsversuche vom Helden abgelehnt und so schickt sie den Ehemann ihrer Schwester, Gugulana, den Stier des Himmels, um Gilgameschs Reich zu zerstören. Nachdem Hunderte Menschen durch den Amoklauf des Stiers getötet wurden, wird dieser von Enkidu, dem Freund und Mitstreiter Gilgameschs, getötet. Enkidu wird von den Göttern verurteilt, weil er eine Gottheit getötet hat, und zum Tode verurteilt; das Ereignis, das Gilgamesch dann auf seine Suche nach Unsterblichkeit schickt. In der Gilgamesch-Geschichte denkt Inanna/Ishtar nur an sich selbst und das Gleiche gilt auch in „The Descent of Inanna“.
Das Werk beginnt mit der Darstellung, wie Inanna beschließt, in die Unterwelt zu reisen, um an Gugulanas Beerdigung teilzunehmen – einem Tod, den sie herbeigeführt hat – und beschreibt detailliert, wie sie bei ihrer Ankunft behandelt wird. Ereshkigal ist nicht erfreut zu hören, dass ihre Schwester vor den Toren steht, und weist Neti an, sie an jedem der sieben Tore verschiedene Kleidungsstücke und Schmuckstücke ablegen zu lassen, bevor sie sie in den Thronsaal lässt. Als Inanna vor Ereshkigal steht, ist sie nackt, und nachdem die Annuna der Toten ein Urteil über sie gefällt hat, tötet Ereshkigal ihre Schwester und hängt ihre Leiche an die Wand.
Nur durch Inannas Klugheit, ihrem Diener Ninshubur zuvor Anweisungen zu geben, was sie tun soll, und durch Ninshuburs Fähigkeit, die Götter zugunsten ihrer Geliebten zu überzeugen, wird Inanna wieder auferstehen. Trotzdem müssen Inannas Gemahlin Dumuzi und seine Schwester (landwirtschaftliche sterbende und wiederbelebende Gottheiten) dann ihren Platz in der Unterwelt einnehmen, denn es ist das Land ohne Wiederkehr und keine Seele kann zurückkehren, ohne einen Ersatz zu finden. Die Hauptfigur des Stücks ist nicht Inanna, sondern Ereshkigal. Die Königin handelt nach dem Urteil ihrer Berater, der Annuna, die anerkennen, dass Inanna für Gugulanas Tod verantwortlich ist.
Der Text lautet: „Die Annuna, die Richter der Unterwelt, umgab sie.“ Sie haben ein Urteil gegen sie gefällt. Dann richtete Ereshkigal das Auge des Todes auf Inanna. Sie sprach das Wort des Zorns gegen sie. Sie stieß einen Schuldschrei gegen sich aus. Sie hat sie geschlagen. Inanna wurde in eine Leiche verwandelt. Ein Stück verrottendes Fleisch. Und wurde an einem Haken an der Wand aufgehängt.
Inanna wird wegen ihres Verbrechens verurteilt und hingerichtet, aber sie hat diese Möglichkeit offensichtlich vorhergesehen und Anweisungen bei ihrem Diener Ninshubur hinterlassen. Nachdem Ninshubur drei Tage und drei Nächte auf Inanna gewartet hat, folgt er den Befehlen der Göttin, bittet Inannas Vatergott Enki um Hilfe und empfängt zwei Galla (androgyne Dämonen), die ihr dabei helfen sollen, Inanna auf die Erde zurückzubringen. Die Galla dringen „wie Fliegen“ in die Unterwelt ein und heften sich, den spezifischen Anweisungen Enkis folgend, eng an Ereshkigal. Die Königin der Toten ist in Not zu sehen: „Über ihren Körper war kein Leinen ausgebreitet.“ Ihre Brüste waren unbedeckt. Ihr Haar wirbelte wie Lauch um ihren Kopf.
Das Gedicht beschreibt weiterhin die Königin, die die Schmerzen der Wehen erlebt. Die Galla haben Mitleid mit den Schmerzen der Königin, und aus Dankbarkeit bietet sie ihnen jedes Geschenk an, um das sie bitten. Auf Befehl von Enki antworten die Galla: „Wir wünschen uns nur die Leiche, die am Haken an der Wand hängt“ (Wolkstein und Kramer , 67) und Ereshkigal gibt sie ihnen. Die Galla beleben Inanna mit der Nahrung und dem Wasser des Lebens wieder und sie ersteht von den Toten. An diesem Punkt, nachdem Inanna gegangen ist und alles zurückgegeben wurde, was Neti ihr an den sieben Toren genommen hat, muss jemand anderes gefunden werden, der Inannas Platz einnimmt.
Ihr Mann Dumuzi wird von Inanna ausgewählt und seine Schwester Geshtinanna meldet sich freiwillig, ihn zu begleiten; Dumuzi wird sechs Monate in der Unterwelt bleiben und Geshtinanna die anderen sechs, während Inanna, die ursprünglich alle Probleme verursacht hat, weiterhin tun kann, was sie will. „The Descent of Inanna“ hätte bei einem antiken Publikum genauso Anklang gefunden wie heute, wenn man verstanden hätte, wer die Hauptfigur tatsächlich ist. Das Gedicht endet mit den Zeilen: „Heiliger Ereshkigal! Großartig ist Ihr Ruf! Heiliger Ereshkigal! Ich singe dein Lob!
Ereshkigal wird aufgrund ihrer Position als beeindruckende Königin der Toten als Hauptfigur des Werks ausgewählt, und die Botschaft des Gedichts bezieht sich auf Ungerechtigkeit: Wenn einer so mächtigen Göttin wie Ereshkigal die Gerechtigkeit verweigert werden kann und sie den Stachel ertragen kann, dann kann das auch der Fall sein jeder, der das vorgetragene Gedicht liest oder hört. Ereshkigal regiert allein über ihr Königreich, bis der Kriegsgott Nergal ihr Gemahl wird. In einer Version der Geschichte wird Nergal von der Königin verführt, als er die Unterwelt besucht, verlässt sie nach sieben Tagen des Liebesspiels, kehrt dann aber zurück, um sechs Monate im Jahr bei ihr zu bleiben.
Versionen der Geschichte wurden in Ägypten (unter den Amarna-Briefen) aus dem 15. Jahrhundert v. Chr. und in Sultantepe, dem Standort einer antiken assyrischen Stadt, aus dem 7. Jahrhundert v. Chr. gefunden; Doch in der bekanntesten Version aus der neubabylonischen Zeit (ca. 626-539 v. Chr.) manipuliert Enki die Ereignisse, die Nergal als Gemahlin der Königin der Toten in die Unterwelt schicken. Eines Tages bereiteten die Götter ein großes Bankett vor, zu dem alle eingeladen waren. Ereshkigal konnte jedoch nicht teilnehmen, weil sie die Unterwelt nicht verlassen konnte und die Götter nicht herabsteigen konnten, um dort ihr Bankett abzuhalten, weil sie später nicht mehr gehen konnten. Der Gott Enki sandte eine Nachricht an Ereshkigal, um einen Diener zu schicken, der ihr ihren Anteil am Fest zurückbringen könnte, und sie schickte ihren Sohn Namtar.
Als Namtar im Bankettsaal der Götter ankam, standen alle außer dem Kriegsgott Nergal aus Respekt vor seiner Mutter auf. Namtar war beleidigt und wollte Wiedergutmachung für das Unrecht, aber Enki sagte ihm, er solle einfach in die Unterwelt zurückkehren und seiner Mutter erzählen, was passiert sei. Als Ereshkigal von der Respektlosigkeit Nergals erfährt, fordert sie Namtar auf, eine Nachricht an Enki zurückzusenden, in der sie verlangt, dass Nergal geschickt wird, damit sie ihn töten kann. Die Götter geben dieser Bitte statt und erkennen ihre Berechtigung an, und so wird Nergal gesagt, dass er in die Unterwelt reisen muss.
Enki hat natürlich verstanden, dass dies passieren würde, und stellt Nergal 14 Dämoneneskorten zur Verfügung, die ihn an jedem der sieben Tore der Unterwelt unterstützen. Als Nergal ankommt, kündigt Neti seine Anwesenheit an und Namtar erzählt seiner Mutter, dass der Gott gekommen ist, der sich nicht erheben wollte. Ereshkigal befiehlt, dass er durch jedes der sieben Tore eingelassen werden soll, die dann hinter ihm verschlossen werden sollen, und sie wird ihn töten, wenn er den Thronsaal erreicht. Nachdem Nergal jedoch jedes Tor passiert hat, postiert er zwei seiner Dämoneneskorten, um es offen zu halten, und marschiert zum Thronsaal, wo er Namtar überwältigt und Ereshkigal zu Boden schleift.
Er hebt seine große Axt, um ihr den Kopf abzuschlagen, aber sie fleht ihn an, sie zu verschonen, und verspricht, seine Frau zu werden, wenn er zustimmt, und ihre Macht mit ihm zu teilen. Nergal stimmt zu und scheint Mitleid mit dem zu haben, was er getan hat. Das Gedicht endet mit einem Kuss der beiden und dem Versprechen, dass sie zusammen bleiben werden. Da Nergal oft Probleme auf der Erde verursachte, indem er die Beherrschung verlor und Krieg und Streit auslöste, wurde vermutet, dass Enki das gesamte Szenario arrangiert hatte, um ihn aus dem Weg zu räumen. Krieg wurde jedoch als Teil der menschlichen Erfahrung anerkannt und so konnte Nergal nicht dauerhaft in der Unterwelt bleiben, sondern musste sechs Monate im Jahr an die Oberfläche zurückkehren.
Da er seine Dämoneneskorte an den Toren postiert hatte, aus freien Stücken angekommen war und von der Königin eingeladen worden war, als Gemahl zu bleiben, konnte Nergal gehen, ohne einen Ersatz finden zu müssen. Wie in „The Descent of Inanna“ berührt die Symbolik der Hochzeit von Ereshkigal und Nergal (beide Versionen) dieselben Themen wie die griechische Geschichte von Demeter, der Göttin der Natur und bounty , und ihrer Tochter Persephone, die vom Hades entführt wird . In der griechischen Sage muss Persephone, nachdem sie von den Früchten der Toten gegessen hatte, ein halbes Jahr mit Hades in der Unterwelt verbringen, und während dieser Zeit trauerte Demeter um den Verlust ihrer Tochter.
Diese Geschichte erklärte die Jahreszeiten dadurch, dass die Welt blühte, als Demeter und Persephone zusammen waren, aber als Persephone in die Unterwelt zurückkehrte, wuchs nichts und die Erde war kalt. „Der Abstieg von Inanna“ entspricht direkt, während „Die Hochzeit von Ereshkigal und Nergal“ die Jahreszeiten des Krieges erklärt, da Konflikte nur in bestimmten Jahreszeiten ausgetragen wurden. Ereshkigal wird in Gebeten und Ritualen immer als eine beeindruckende Göttin mit großer Macht dargestellt, in Geschichten jedoch oft als eine, die im Interesse des Allgemeinwohls Ungerechtigkeit oder Unrecht vergibt.
In dieser Rolle förderte sie die Frömmigkeit der Menschen, die ihrem Beispiel in ihrem eigenen Leben folgen sollten. Wenn Ereshkigal Ungerechtigkeit erleiden und weiterhin ihre Aufgaben im Einklang mit dem Willen der Götter erfüllen könnte, dann sollten die Menschen nicht weniger tun. Ihre weitere Bedeutung bestand darin, dass sie als Herrscherin der Unterwelt die Guten belohnte und die Bösen bestrafte, aber noch wichtiger war, dass sie die Toten in dem Reich hielt, in das sie gehörten. Die sieben Tore der Unterwelt wurden nicht gebaut, um irgendjemanden draußen zu halten, sondern um alle, die dorthin gehörten, drinnen zu halten.
Rund um Ereshkigal entstand ein Totenkult, um diejenigen zu ehren, die in ihr Reich eingetreten waren, und sich weiterhin an sie zu erinnern und für sie zu sorgen. Da die Toten nichts außer schlammigem Wasser zum Trinken und Staub zum Essen hatten, wurde Essen auf die Gräber gelegt und frisches Wasser gegossen, von dem man annahm, dass es in den Mund des Verstorbenen tropfte. Der Gelehrte EA Wallis Budge schreibt:
„Die Tränen der Lebenden trösteten die Toten und ihre Klagen und Klagelieder trösteten sie. Um das Verlangen der Verstorbenen zu stillen, wurden diese Opfergaben manchmal von Priestern dargebracht, die ihr Leben dem Totenkult widmeten, und die Verwandten der Verstorbenen nutzten sie oft, um Beschwörungsformeln zu rezitieren, die eine Verbesserung des Schicksals der Verstorbenen bewirken sollten das schreckliche Königreich Ereshkigal ... Das Hauptziel all dieser frommen Taten war es, den Toten zu helfen, aber dahinter steckte der glühende Wunsch der Lebenden, die Toten in der Unterwelt zu behalten. Die Lebenden hatten Angst davor, dass die Toten in diese Welt zurückkehren könnten, und es war notwendig, eine solche Katastrophe um jeden Preis zu vermeiden.
Ereshkigal sorgte wie alle Götter Mesopotamiens für Ordnung und stellte sich den Kräften des Chaos entgegen. Die Seelen, die die Welt der Lebenden verlassen hatten, sollten nicht zurückkehren, und Ereshkigal sorgte dafür, dass sie dort blieben, wo sie hingehören. Wenn ein Geist zurückkommen sollte, um die Lebenden zu heimsuchen, konnte man sicher sein, dass dies aus gutem Grund und mit Ereshkigals Erlaubnis geschah. Wie in anderen Kulturen waren die Hauptgründe für einen Spuk die unsachgemäße Bestattung der Toten oder gottlose Taten, die ungestraft blieben. Als Königin und Hüterin der Toten war Ereshkigal eine starke Erinnerung an die Lebenden, die richtigen Riten und Rituale in ihrem Leben einzuhalten und im besten Interesse ihrer unmittelbaren und größeren Gemeinschaften zu handeln. [Enzyklopädie der antiken Geschichte].
ÜBERPRÜFEN: Lilith (entwickelt aus dem baylonischen Lilitu) ist eine Figur in der jüdischen Mythologie, die am frühesten im babylonischen Talmud (3. bis 5. Jahrhundert) entwickelt wurde. Lilith wird oft als gefährlicher Dämon der Nacht dargestellt, der sexuell mutwillig ist und in der Dunkelheit Babys stiehlt. Es wird allgemein angenommen, dass die Figur teilweise aus einer historisch weitaus früheren Klasse weiblicher Dämonen (lilītu) in der antiken mesopotamischen Religion stammt, die in Keilschrifttexten von Sumer, dem Akkadischen Reich, Assyrien und Babylonien zu finden ist.
In der jüdischen Folklore erscheint Lilith ab dem satirischen Buch Alphabet of Sirach (ca. 700–1000) als Adams erste Frau, die zur gleichen Zeit (Rosh Hashanah) und aus demselben Boden wie Adam erschaffen wurde – vergleiche Genesis 1:27 . Dies steht im Gegensatz zu Eva, die aus einer Rippe Adams erschaffen wurde: Genesis 2:22. Die Legende entwickelte sich im Mittelalter in der Tradition der Aggada, des Sohar und der jüdischen Mystik umfassend.
In den Schriften von Isaac ben Jacob ha-Cohen aus dem 13. Jahrhundert beispielsweise verließ Lilith Adam, nachdem sie sich weigerte, sich ihm unterzuordnen, und kehrte dann nicht in den Garten Eden zurück, nachdem sie sich mit dem Erzengel Samael verbunden hatte. In späteren jüdischen Materialien gibt es zahlreiche Beweise, es sind jedoch nur wenige Informationen über die ursprüngliche sumerische, akkadische, assyrische und babylonische Sicht auf diese Dämonen erhalten.
ÜBERPRÜFEN: Babylon ist die berühmteste Stadt aus dem alten Mesopotamien, deren Ruinen im heutigen Irak 59 Meilen (94 Kilometer) südwestlich von Bagdad liegen. Es wird angenommen, dass der Name von bav-il oder bav-ilim abgeleitet ist, was in der damaligen akkadischen Sprache „Tor Gottes“ oder „Tor der Götter“ bedeutete und „Babylon“ aus dem Griechischen stammte. Die Stadt verdankt ihren Ruhm (oder ihre Schande) den vielen Hinweisen in der Bibel; allesamt ungünstig. Im Buch Genesis, Kapitel 11, wird Babylon in der Geschichte vom Turmbau zu Babel erwähnt, und die Hebräer behaupteten, die Stadt sei wegen der Verwirrung benannt worden, die entstand, nachdem Gott die Menschen dazu gebracht hatte, in verschiedenen Sprachen zu sprechen, damit sie nicht dazu in der Lage waren um ihren großen Turm bis zum Himmel zu vollenden (das hebräische Wort bavel bedeutet „Verwirrung“).
Babylon erscheint unter anderem auch in den biblischen Büchern Daniel, Jeremia und Jesaja und vor allem im Buch der Offenbarung prominent. Es waren diese biblischen Hinweise, die das Interesse an der mesopotamischen Archäologie und der Expedition des deutschen Archäologen Robert Koldewey weckten, der 1899 n. Chr. erstmals die Ruinen von Babylon ausgrub. Abgesehen von dem sündigen Ruf, den die Bibel ihr verleiht, ist die Stadt für ihre beeindruckenden Mauern bekannt Gebäude, sein Ruf als großer Ort der Bildung und Kultur, die Entstehung eines Gesetzeskodex, der vor dem mosaischen Gesetz entstand, und für die Hängenden Gärten von Babylon, bei denen es sich um künstliche Terrassen mit Flora und Fauna handelte, die von Maschinen bewässert wurden, die von Herodot als eines der sieben Weltwunder bezeichnet wurden.
Babylon wurde irgendwann vor der Herrschaft von Sargon von Akkad (auch bekannt als Sargon der Große) gegründet, der von 2334 bis 2279 v. Chr. regierte und behauptete, in Babylon Tempel gebaut zu haben (andere antike Quellen scheinen darauf hinzuweisen, dass Sargon selbst die Stadt gegründet hat). ). Zu dieser Zeit scheint Babylon eine kleine Stadt oder vielleicht eine große Hafenstadt am Euphrat gewesen zu sein, an der Stelle, an der er am nächsten zum Tigris fließt. Welche frühe Rolle die Stadt in der Antike spielte, ist den heutigen Gelehrten nicht mehr bekannt, da der Wasserspiegel in der Region im Laufe der Jahrhunderte stetig gestiegen ist und die Ruinen von Alt-Babylon unzugänglich geworden sind.
Die von Koldewey ausgegrabenen und heute sichtbaren Ruinen stammen erst weit über tausend Jahre nach der Gründung der Stadt. Der Historiker Paul Kriwaczek behauptet neben anderen Gelehrten, dass sie von den Amoritern nach dem Zusammenbruch der dritten Dynastie von Ur gegründet wurde. Diese Informationen und alle anderen Informationen über Alt-Babylon erreichen uns heute durch Artefakte, die nach der persischen Invasion aus der Stadt verschleppt wurden oder anderswo geschaffen wurden. Die bekannte Geschichte Babylons beginnt also mit seinem berühmtesten König: Hammurabi (1792-1750 v. Chr.). Dieser obskure amoritische Prinz bestieg den Thron nach der Abdankung seines Vaters, König Sin-Muballit, und verwandelte die Stadt ziemlich schnell in eine der mächtigsten und einflussreichsten Städte in ganz Mesopotamien.
Hammurabis Gesetzbücher sind wohlbekannt, aber sie sind nur ein Beispiel für die Maßnahmen, die er zur Wahrung des Friedens und zur Förderung des Wohlstands umsetzte. Er vergrößerte und erhöhte die Stadtmauern, führte große öffentliche Bauarbeiten durch, darunter opulente Tempel und Kanäle, und machte die Diplomatie zu einem integralen Bestandteil seiner Verwaltung. Er war sowohl in der Diplomatie als auch im Krieg so erfolgreich, dass er 1755 v. Chr. ganz Mesopotamien unter der Herrschaft Babylons vereinte, das zu dieser Zeit die größte Stadt der Welt war, und sein Reich Babylonien nannte.
Nach Hammurabis Tod zerfiel sein Reich und Babylonien schrumpfte an Größe und Umfang, bis Babylon 1595 v. Chr. problemlos von den Hethitern geplündert wurde. Die Kassiten folgten den Hethitern und benannten die Stadt in Karanduniash um. Die Bedeutung dieses Namens ist nicht klar. Die Assyrer folgten dann den Kassiten und beherrschten die Region, und unter der Herrschaft des assyrischen Herrschers Sennacherib (reg. 705–681 v. Chr.) kam es zu einem Aufstand in Babylon. Sanherib ließ die Stadt plündern, dem Erdboden gleichmachen und die Ruinen verstreuen, um anderen eine Lektion zu erteilen. Seine extremen Maßnahmen wurden vom Volk im Allgemeinen und von Sennacheribs Hof im Besonderen als gottlos angesehen und er wurde bald darauf von seinen Söhnen ermordet.
Sein Nachfolger Asarhaddon baute Babylon wieder auf und erstrahlte wieder in altem Glanz. Später erhob sich die Stadt in einer Revolte gegen Assurbanipal von Ninive, der die Stadt belagerte und besiegte, ihr aber keinen großen Schaden zufügte und Babylon tatsächlich persönlich von den bösen Geistern reinigte, die angeblich zu den Unruhen geführt hatten. Der Ruf der Stadt als Zentrum des Lernens und der Kultur war zu dieser Zeit bereits fest verankert. Nach dem Untergang des Assyrischen Reiches bestieg ein Chaldäer namens Nabopolassar den Thron von Babylon und gründete durch sorgfältige Allianzen das Neubabylonische Reich. Sein Sohn Nebukadnezar II. (604–561 v. Chr.) renovierte die Stadt, so dass sie eine Fläche von 900 Hektar (2.200 Acres) umfasste und einige der schönsten und beeindruckendsten Bauwerke in ganz Mesopotamien aufwies.
Jeder antike Schriftsteller, der die Stadt Babylon erwähnt, außer denen, die für die Geschichten in der Bibel verantwortlich sind, tut dies mit einem Ton der Ehrfurcht und Ehrfurcht. Herodot schreibt zum Beispiel: „Die Stadt liegt auf einer weiten Ebene und ist ein genaues Quadrat mit einer Länge von jeweils einhundertzwanzig Stadien, so dass der gesamte Ring vierhundertachtzig Stadien umfasst.“ Obwohl die Stadt so groß ist, gibt es keine andere Stadt, die an Pracht herankommt. Es ist in erster Linie von einem breiten und tiefen Wassergraben umgeben, hinter dem sich eine Mauer von fünfzig königlichen Ellen in der Breite und zweihundert in der Höhe erhebt Seine Beschreibung spiegelt die Bewunderung anderer Schriftsteller jener Zeit wider, die die Pracht Babylons und insbesondere der großen Mauern als Weltwunder beschrieben. Unter der Herrschaft Nebukadnezars II. sollen die Hängenden Gärten von Babylon errichtet und das berühmte Ischtar-Tor gebaut worden sein. Die Hängenden Gärten werden am deutlichsten in einer Passage von Diodorus Siculus (90–30 v. Chr.) in seinem Werk Bibliotheca Historica Buch II.10 beschrieben:
„Es gab auch, wegen der Akropolis, den Hängenden Garten, wie er genannt wird, der nicht von Semiramis, sondern von einem späteren syrischen König erbaut wurde, um einer seiner Konkubinen zu gefallen; denn sie war, wie man sagt, ihrer Abstammung nach eine Perserin Da sie sich nach den Wiesen ihrer Berge sehnte, bat sie den König, durch die Kunstfertigkeit eines bepflanzten Gartens die charakteristische Landschaft Persiens nachzuahmen. Der Park erstreckte sich auf jeder Seite um vier Plethra, und da der Zugang zum Garten wie ein Hügel abfiel und die verschiedenen Teile des Bauwerks Reihe für Reihe ineinander übergingen, ähnelte das Gesamtbild dem eines Theaters.“
„Als die aufsteigenden Terrassen gebaut waren, wurden darunter Galerien angelegt, die das gesamte Gewicht des bepflanzten Gartens trugen und sich entlang des Zugangs nach und nach übereinander erhoben; und die oberste Galerie, die fünfzig Ellen hoch war, trug die höchste Fläche des Parks, die auf gleicher Höhe mit der Ringmauer der Stadtmauer liegt. Darüber hinaus waren die mit großem Aufwand errichteten Mauern 22 Fuß dick, während der Durchgang zwischen den beiden Mauern jeweils 10 Fuß breit war. Die Dächer der Galerien waren mit Steinbalken bedeckt, die einschließlich der Überlappung sechzehn Fuß lang und vier Fuß breit waren.
„Das Dach über diesen Balken hatte zunächst eine Schicht Schilfrohr, die in großen Mengen Bitumen verlegt war, darüber zwei Lagen gebrannter Ziegel, die mit Zement verbunden waren, und als dritte Schicht eine Abdeckung aus Blei, um die Feuchtigkeit aus dem Boden abzuhalten nicht darunter eindringen. Auf all dies war wiederum Erde bis zu einer Tiefe aufgeschüttet worden, die für die Wurzeln der größten Bäume ausreichte; und der Boden, der geebnet war, war dicht mit Bäumen aller Art bepflanzt, die durch ihre Größe oder irgendeinen anderen Reiz dem Betrachter Freude bereiten konnten.“
„Und da die Galerien, von denen jede über die andere hinausragte, alle das Licht empfingen, enthielten sie viele königliche Unterkünfte aller Art; und es gab eine Galerie, die Öffnungen enthielt, die von der obersten Oberfläche ausführten, und Maschinen zur Wasserversorgung des Gartens, wobei die Maschinen angehoben wurden Sie schöpften reichlich Wasser aus dem Fluss, obwohl niemand draußen sehen konnte, wie es geschah. Nun, dieser Park war, wie ich bereits sagte, ein späterer Bau.“
Dieser Teil von Diodorus‘ Werk betrifft die halbmythische Königin Semiramis (höchstwahrscheinlich basierend auf der tatsächlichen assyrischen Königin Sammu-Ramat, die 811–806 v. Chr. regierte). Sein Hinweis auf „einen späteren syrischen König“ folgt Herodots Tendenz, Mesopotamien als „Assyrien“ zu bezeichnen. Neuere Forschungen zu diesem Thema gehen davon aus, dass sich die Hängenden Gärten nie in Babylon befanden, sondern vielmehr die Schöpfung Sennacheribs in seiner Hauptstadt Ninive waren. Der Historiker Christopher Scarre schreibt:
„Sennacheribs Palast [in Ninive] verfügte über alle üblichen Annehmlichkeiten einer großen assyrischen Residenz: kolossale Wächterfiguren und eindrucksvoll geschnitzte Steinreliefs (über 2.000 Skulpturenplatten in 71 Räumen). Auch seine Gärten waren außergewöhnlich.“ Jüngste Forschungen der britischen Assyriologin Stephanie Dalley haben ergeben, dass es sich dabei um die berühmten Hängenden Gärten handelte, eines der sieben Weltwunder der Antike. Spätere Autoren platzierten die Hängenden Gärten in Babylon, doch umfangreiche Nachforschungen konnten keine Spur davon finden. Sanheribs stolzer Bericht über die Palastgärten, die er in Ninive angelegt hat, stimmt in mehreren wichtigen Details mit dem über die Hängenden Gärten überein.“
Diese Zeit, in der angeblich die Hängenden Gärten gebaut wurden, war auch die Zeit des babylonischen Exils der Juden und die Zeit, in der der babylonische Talmud geschrieben wurde. Der Euphrat teilte die Stadt in eine „alte“ und eine „neue“ Stadt mit dem Marduk-Tempel und der großen, hoch aufragenden Zikkurat in der Mitte. Straßen und Alleen wurden verbreitert, um der jährlichen Prozession der Statue des großen Gottes Marduk auf dem Weg von seinem Heimattempel in der Stadt zum Neujahrsfesttempel vor dem Ischtar-Tor besser gerecht zu werden.
Das neubabylonische Reich bestand auch nach dem Tod von Nebukadnezar II. weiter und Babylon spielte unter der Herrschaft von Nabonid und seinem Nachfolger Belsazar (im biblischen Buch Daniel erwähnt) weiterhin eine wichtige Rolle in der Region. Im Jahr 539 v. Chr. fiel das Reich in der Schlacht von Opis an die Perser unter Kyros dem Großen. Die Mauern Babylons waren uneinnehmbar, und so entwickelten die Perser einen geschickten Plan, mit dem sie den Lauf des Euphrat so umleiteten, dass er auf eine überschaubare Tiefe abfiel. Während die Bewohner der Stadt von einem ihrer großen religiösen Festtage abgelenkt waren, watete die persische Armee unbemerkt durch den Fluss und marschierte unter den Mauern Babylons hindurch.
Es wurde behauptet, die Stadt sei kampflos eingenommen worden, obwohl aus damaligen Dokumenten hervorgeht, dass Reparaturen an den Mauern und einigen Teilen der Stadt vorgenommen werden mussten und die Aktion daher möglicherweise nicht so mühelos verlief, wie im persischen Bericht behauptet wird. Unter persischer Herrschaft blühte Babylon als Zentrum für Kunst und Bildung auf. Cyrus und seine Nachfolger schätzten die Stadt sehr und machten sie zur Verwaltungshauptstadt ihres Reiches (obwohl sich der persische Kaiser Xerxes irgendwann nach einem weiteren Aufstand gezwungen sah, die Stadt zu belagern).
Die babylonische Mathematik, Kosmologie und Astronomie genossen hohes Ansehen und es wird vermutet, dass Thales von Milet (bekannt als der erste westliche Philosoph) dort studiert hat und dass Pythagoras seinen berühmten mathematischen Satz auf der Grundlage eines babylonischen Modells entwickelt hat. Als das Persische Reich nach zweihundert Jahren im Jahr 331 v. Chr. an Alexander den Großen fiel, erwies er der Stadt ebenfalls große Ehrerbietung und befahl seinen Männern, weder die Gebäude zu beschädigen noch die Bewohner zu belästigen.
Der Historiker Stephen Bertman schreibt: „Vor seinem Tod befahl Alexander der Große, den Aufbau der Zikkurat Babylons abzureißen, damit er in größerer Pracht wieder aufgebaut werden konnte.“ Doch er erlebte die Vollendung seines Projekts nie mehr. Im Laufe der Jahrhunderte wurden die verstreuten Ziegelsteine von Bauern ausgeschlachtet, um bescheidenere Träume zu verwirklichen. Vom sagenumwobenen Turmbau zu Babel ist nur noch der Grund eines sumpfigen Teichs übrig.“ Nach Alexanders Tod in Babylon kämpften seine Nachfolger (bekannt als „Die Diadochen“, griechisch für „Nachfolger“) um sein Reich im Allgemeinen und die Stadt im Besonderen, bis zu dem Punkt, an dem die Bewohner aus Sicherheitsgründen flohen (oder, einem alten Bericht zufolge, wurden verlegt). Als das Partherreich im Jahr 141 v. Chr. die Region beherrschte, war Babylon verlassen und vergessen. Die Stadt verfiel immer mehr und erreichte selbst während einer kurzen Wiederbelebung unter den sassanidischen Persern nie wieder ihre frühere Größe.
Bei der muslimischen Eroberung des Landes im Jahr 650 n. Chr. wurde alles, was von Babylon übrig geblieben war, weggeschwemmt und mit der Zeit unter den Sanden begraben. Im 17. und 18. Jahrhundert n. Chr. begannen europäische Reisende, die Gegend zu erkunden und kehrten mit verschiedenen Artefakten nach Hause zurück. Diese Keilschriftblöcke und Statuen führten zu einem erhöhten Interesse an der Region und im 19. Jahrhundert n. Chr. zog das Interesse an der biblischen Archäologie Männer wie Robert Koldewey an, der die Ruinen der einst großen Stadt des Tores der Götter freilegte. [Enzyklopädie der antiken Geschichte].
ÜBERPRÜFEN: Babylon war vom 18. bis 6. Jahrhundert v. Chr. ein Schlüsselkönigreich im alten Mesopotamien. Die Stadt wurde am Euphrat erbaut und entlang seines linken und rechten Ufers in gleiche Teile geteilt, mit steilen Böschungen, um die saisonalen Überschwemmungen des Flusses einzudämmen. Babylon war ursprünglich eine kleine akkadische Stadt aus der Zeit des Akkadischen Reiches um 2300 v. Chr. Mit dem Aufstieg der ersten amoritischen babylonischen Dynastie im 19. Jahrhundert v. Chr. wurde die Stadt Teil eines kleinen unabhängigen Stadtstaates
Nachdem der Amoriterkönig Hammurabi im 18. Jahrhundert v. Chr. ein kurzlebiges Reich geschaffen hatte, baute er Babylon zu einer Großstadt aus und erklärte sich selbst zu ihrem König. Südmesopotamien wurde als Babylonien bekannt und Babylon übertraf Nippur als seine heilige Stadt. Das Reich schwand unter Hammurabis Sohn Samsu-iluna und Babylon verbrachte lange Zeit unter der Herrschaft der Assyrer, Kassiten und Elamiter. Nach der Zerstörung und dem Wiederaufbau durch die Assyrer wurde Babylon von 609 bis 539 v. Chr. zur Hauptstadt des kurzlebigen neubabylonischen Reiches
Die Hängenden Gärten von Babylon waren eines der sieben Weltwunder der Antike, obwohl einige Gelehrte glauben, dass sie sich tatsächlich in der assyrischen Hauptstadt Ninive befanden. Nach dem Untergang des Neubabylonischen Reiches geriet die Stadt unter die Herrschaft der Achämeniden, Seleukiden, Parther, Römer und Sassaniden. Schätzungen zufolge war Babylon zwischen 1770 und 1670 v. Chr. und erneut zwischen 612 und 320 v. Chr. die größte Stadt der Welt. Es war möglicherweise die erste Stadt, die eine Bevölkerung von über 200.000 erreichte. Die maximale Fläche wird auf 890 bis 900 Hektar (2.200 Acres) geschätzt.
Die Überreste der Stadt befinden sich im heutigen Hillah, Gouvernement Babil, Irak, etwa 85 Kilometer (53 Meilen) südlich von Bagdad und bestehen aus einer großen Ansammlung zerbrochener Lehmziegelgebäude und Trümmern. Die wichtigsten Informationsquellen über Babylon sind Ausgrabungen der Stätte selbst, Hinweise in Keilschrifttexten, die anderswo in Mesopotamien gefunden wurden, Hinweise in der Bibel, Beschreibungen in klassischen Schriften (insbesondere von Herodot) und Beschreibungen aus zweiter Hand (unter Berufung auf die Werke von Ktesias und Berossus) – zeichnen ein unvollständiges und manchmal widersprüchliches Bild der antiken Stadt selbst auf ihrem Höhepunkt im 6. Jahrhundert v. Chr
Der englische Name „Babylon“ kommt vom griechischen „Babylon“, einer Transliteration des akkadischen Babilim. Der babylonische Name im frühen 2. millennium v. Chr. war Babilli oder Babilla, was lange Zeit als „Tor Gottes“ (Bab-Ili) galt. In der Bibel erscheint der Name als Babel, was im Buch Genesis der Hebräischen Schriften als „Verwirrung“ interpretiert wird, abgeleitet vom Verb bilbél. In alten Aufzeichnungen wird Babylon in manchen Situationen als Name für andere Städte verwendet, darunter Städte wie Borsippa innerhalb des Einflussbereichs Babylons und Ninive für kurze Zeit nach der Plünderung Babylons durch die Assyrer.
Die heutige Stätte des antiken Babylon besteht aus einer Reihe von Hügeln, die eine Fläche von etwa 2 mal 1 Kilometer (1,24 × 0,62 Meilen) entlang des Euphrat im Westen bedecken. Ursprünglich teilte der Fluss die Stadt ungefähr in zwei Hälften, doch seitdem hat sich der Flusslauf verändert, so dass heute die meisten Überreste des ehemaligen Westteils der Stadt überschwemmt sind. Einige Teile der Stadtmauer westlich des Flusses sind ebenfalls erhalten. Nur ein kleiner Teil der antiken Stadt (3 % der Fläche innerhalb der Innenmauern; 1,5 % der Fläche innerhalb der Außenmauern; 0,05 % in der Tiefe von Mittel- und Altbabylon) wurde ausgegraben.
Zu den bekannten Überresten gehören: Kasr – auch Palast oder Burg genannt. Es ist der Standort der neubabylonischen Zikkurat Etemenanki und liegt im Zentrum der Stätte. Amran Ibn Ali; der höchste der Hügel liegt mit 25 Metern im Süden. Hier befindet sich Esagila, ein Marduk-Tempel, der auch Schreine für Ea und Nabu enthielt. Homera; ein rötlich gefärbter Hügel auf der Westseite. Die meisten hellenistischen Überreste befinden sich hier. Babil; ein etwa 22 Meter hoher Hügel am nördlichen Ende des Geländes. Seine Ziegel wurden seit der Antike geplündert. Dort befand sich ein von Nebukadnezar erbauter Palast.
Archäologen haben nur wenige Artefakte aus der Zeit vor der neubabylonischen Zeit geborgen. Der Grundwasserspiegel in der Region ist im Laufe der Jahrhunderte stark gestiegen und Artefakte aus der Zeit vor dem Neubabylonischen Reich sind für die aktuellen archäologischen Standardmethoden nicht zugänglich. Darüber hinaus führten die Neubabylonier bedeutende Wiederaufbauprojekte in der Stadt durch, die einen Großteil der früheren Aufzeichnungen zerstörten oder verdunkelten. Babylon wurde nach dem Aufstand gegen die Fremdherrschaft mehrfach geplündert.
Dies geschah vor allem im zweiten millennium durch die Hethiter und Elamiter, dann durch das Neo-Assyrische Reich und das Achämenidenreich im ersten millennium . Ein Großteil der westlichen Hälfte der Stadt liegt heute unterhalb des Flusses, und andere Teile des Geländes wurden für kommerzielle Baumaterialien abgebaut. Nur die Koldewey-Expedition hat Artefakte aus der altbabylonischen Zeit geborgen. Dazu gehörten 967 in Privathäusern aufbewahrte Tontafeln mit sumerischer Literatur und lexikalischen Dokumenten. Nahe gelegene antike Siedlungen sind Kish, Borsippa, Dilbat und Kutha. Marad und Sippar lagen 60 Kilometer in beide Richtungen am Euphrat.
Das historische Wissen über das frühe Babylon muss aus epigraphischen Überresten zusammengesetzt werden, die anderswo gefunden wurden, beispielsweise in Uruk, Nippur und Haradum. Informationen über die neubabylonische Stadt sind aus archäologischen Ausgrabungen und aus klassischen Quellen verfügbar. Babylon wurde von einer Reihe klassischer Historiker beschrieben, vielleicht sogar besucht, darunter Ktesias, Herodot, Quintus Curtius Rufus, Strabo und Cleitarchus. Diese Berichte sind von unterschiedlicher Genauigkeit und einige Inhalte waren politisch motiviert, liefern aber dennoch nützliche Informationen.
Hinweise auf die Stadt Babylon finden sich in der akkadischen und sumerischen Literatur aus dem späten dritten millennium v. Chr. Eine der frühesten ist eine Tafel, auf der beschrieben wird, wie der akkadische König Šar-kali-šarri in Babylon den Grundstein für neue Tempel für Annūnı̄tum und Ilaba legte. Babylon erscheint auch in den Verwaltungsunterlagen der Dritten Dynastie von Ur, die Sachsteuerzahlungen eintrieb und einen Ensi zum örtlichen Gouverneur ernannte. Die sogenannte Weidner-Chronik besagt, dass Sargon von Akkad (ca. 23. Jahrhundert v. Chr. in der Kurzchronologie) Babylon „vor Akkad“ erbaut hatte. In einer späteren Chronik heißt es, Sargon habe „den Schmutz der Grube Babylons ausgegraben und neben Akkad ein Gegenstück zu Babylon geschaffen“.
Van de Mieroop hat vorgeschlagen, dass sich diese Quellen eher auf den viel späteren assyrischen König Sargon II. des Neo-Assyrischen Reiches als auf Sargon von Akkad beziehen. Im Buch Genesis, Kapitel 10, wird behauptet, dass König Nimrod Babel, Uruk und Akkad gegründet habe. Ctesias, zitiert von Diodorus Siculus und in George Syncellus‘ Chronographia, behauptete, Zugang zu Manuskripten aus babylonischen Archiven zu haben, die die Gründung Babylons auf das Jahr 2286 v. Chr. unter der Herrschaft seines ersten Königs Belus datieren. Eine ähnliche Zahl findet sich in den Schriften von Berossus, der laut Plinius angab, dass astronomische Beobachtungen in Babylon 490 Jahre vor der griechischen Ära des Phoroneus begannen, was auf das Jahr 2243 v. Chr. hinweist
Stephanus von Byzanz schrieb, dass Babylon 1002 Jahre vor dem von Hellanikos von Lesbos für die Belagerung Trojas (1229 v. Chr.) angegebenen Datum erbaut wurde, was die Gründung Babylons auf das Jahr 2231 v. Chr. datieren würde. Alle diese Daten deuten darauf hin, dass Babylons Gründung im 23. Jahrhundert v. Chr. erfolgte; Es wurde jedoch nicht festgestellt, dass Keilschriftaufzeichnungen mit diesen klassischen (postkeilschriftlichen) Berichten übereinstimmen. Es ist bekannt, dass etwa im 19. Jahrhundert v. Chr. ein Großteil Südmesopotamiens von Amoritern besetzt war, Nomadenstämmen aus der nördlichen Levante, die Nordwestsemitisch sprachen, im Gegensatz zu den einheimischen Akkadiern Südmesopotamiens und Assyriens, die Ostsemitisch sprachen.
Die Amoriter betrieben zunächst keine Landwirtschaft wie die fortgeschritteneren Mesopotamier, sondern bevorzugten einen halbnomadischen Lebensstil und hüteten Schafe. Im Laufe der Zeit erlangten die amoritischen Getreidehändler eine herausragende Stellung und gründeten ihre eigenen unabhängigen Dynastien in mehreren südmesopotamischen Stadtstaaten, vor allem in Isin, Larsa, Eshnunna, Lagash, und gründeten später Babylon als Staat. Laut einer babylonischen Datumsliste begann die Herrschaft der Amoriter in Babylon (ca. 19. oder 18. Jahrhundert v. Chr.) mit einem Häuptling namens Sumu-abum, der die Unabhängigkeit vom benachbarten Stadtstaat Kazallu erklärte.
Sumu-la-El, dessen Daten möglicherweise mit denen von Sumu-abum übereinstimmen, wird üblicherweise als Stammvater der ersten babylonischen Dynastie angegeben. Beiden wird der Bau der Mauern Babylons zugeschrieben. Auf jeden Fall beschreiben die Aufzeichnungen die militärischen Erfolge von Sumu-la-El bei der Schaffung eines regionalen Einflussbereichs für Babylon. Babylon war ursprünglich ein kleiner Stadtstaat und kontrollierte nur wenige umliegende Gebiete; seine ersten vier amoritischen Herrscher nahmen nicht den Titel eines Königs an. Die älteren und mächtigeren Staaten Assyrien, Elam, Isin und Larsa überschatteten Babylon, bis es etwa ein Jahrhundert später zur Hauptstadt von Hammurabis kurzlebigem Reich wurde.
Hammurabi (reg. 1792–1750 v. Chr.) ist berühmt für die Kodifizierung der Gesetze Babyloniens im Kodex von Hammurabi. Er eroberte alle Städte und Stadtstaaten Südmesopotamiens, darunter Isin, Larsa, Ur, Uruk, Nippur, Lagash, Eridu, Kish, Adab, Eshnunna, Akshak, Akkad, Shuruppak, Bad-tibira, Sippar und Girsu, und vereinte sie in ein Königreich, das von Babylon aus regiert wird. Hammurabi fiel auch in Elam im Osten ein und eroberte es sowie die Königreiche Mari und Ebla im Nordwesten.
Nach einem langwierigen Kampf mit dem mächtigen assyrischen König Ishme-Dagan aus dem Altassyrischen Reich zwang er seinen Nachfolger gegen Ende seiner Herrschaft, Tribut zu zahlen, und weitete die babylonische Macht auf die Hattier- und Hurriter-Kolonien Assyriens in Kleinasien aus. Nach der Herrschaft Hammurabis wurde ganz Südmesopotamien als Babylonien bekannt, während der Norden bereits Jahrhunderte zuvor zu Assyrien verschmolzen war. Von diesem Zeitpunkt an verdrängte Babylon Nippur und Eridu als die wichtigsten religiösen Zentren Südmesopotamiens.
Hammurabis Reich destabilisierte sich nach seinem Tod. Die Assyrer besiegten und vertrieben die Babylonier und Amoriter. Der äußerste Süden Mesopotamiens spaltete sich ab und bildete die einheimische Sealand-Dynastie, und die Elamiten eigneten sich Gebiete im Osten Mesopotamiens an. Die Amoriter-Dynastie blieb in Babylon an der Macht, das wieder zu einem kleinen Stadtstaat wurde. Texte aus dem alten Babylon enthalten häufig Hinweise auf Schamasch, den Sonnengott von Sippar, der als höchste Gottheit behandelt wird, und auf Marduk, der als sein Sohn gilt. Marduk wurde später in einen höheren Status erhoben und Schamasch herabgestuft, was möglicherweise die wachsende politische Macht Babylons widerspiegelte.
Im Jahr 1595 v. Chr. wurde die Stadt vom Hethiterreich aus Kleinasien gestürzt. Danach eroberten Kassiten aus dem Zagros-Gebirge im Nordwesten des antiken Iran Babylon und leiteten eine Dynastie ein, die 435 Jahre bis 1160 v. Chr. Bestand hatte. In dieser Zeit wurde die Stadt in Karanduniash umbenannt. Das kassitische Babylon wurde schließlich im Norden dem Mittelassyrischen Reich (1365–1053 v. Chr.) und im Osten Elam unterworfen, wobei beide Mächte um die Kontrolle über die Stadt wetteiferten. Der assyrische König Tukulti-Ninurta I. bestieg 1235 v. Chr. den Thron von Babylon
Chr. wurden die Kassiten nach anhaltenden Angriffen und der Annexion von Gebieten durch die Assyrer und Elamiter in Babylon abgesetzt. Dann herrschte erstmals eine akkadische südmesopotamische Dynastie. Babylon blieb jedoch schwach und der Herrschaft Assyriens unterworfen. Seine wirkungslosen einheimischen Könige waren nicht in der Lage, neue Wellen ausländischer westsemitischer Siedler aus den Wüsten der Levante zu verhindern, darunter die Aramäer und Suteaner im 11. Jahrhundert v. Chr. und schließlich die Chaldäer im 9. Jahrhundert v. Chr., die in Gebiete Babyloniens eindrangen und sich diese aneigneten sich. Die Aramäer herrschten im späten 11. Jahrhundert v. Chr. kurzzeitig in Babylon
Während der Herrschaft des Neuassyrischen Reiches (911–609 v. Chr.) stand Babylonien ständig unter assyrischer Herrschaft oder direkter Kontrolle. Während der Herrschaft von Sanherib von Assyrien befand sich Babylonien in einem ständigen Aufstandszustand, angeführt von einem Häuptling namens Merodach-Baladan, im Bündnis mit den Elamiten, und wurde nur durch die vollständige Zerstörung der Stadt Babylon unterdrückt. Im Jahr 689 v. Chr. wurden die Mauern, Tempel und Paläste zerstört und die Trümmer in den Arakhtu geworfen, das Meer, das im Süden an das frühere Babylon grenzte. Die Zerstörung des religiösen Zentrums schockierte viele, und die anschließende Ermordung Sanheribs durch zwei seiner eigenen Söhne, während er zum Gott Nisroch betete, galt als Akt der Sühne.
Infolgedessen beeilte sich sein Nachfolger Esarhaddon, die Altstadt wieder aufzubauen und sie für einen Teil des Jahres zu seiner Residenz zu machen. Nach seinem Tod wurde Babylonien von seinem älteren Sohn, dem assyrischen Prinzen Schamasch-schum-ukin, regiert, der schließlich 652 v. Chr. einen Bürgerkrieg gegen seinen eigenen Bruder Assurbanipal begann, der in Ninive herrschte. Shamash-shum-ukin nahm die Hilfe anderer Assyrien unterworfener Völker in Anspruch, darunter Elam, Persien, Chaldäer und Suteäer im Süden Mesopotamiens sowie der Kanaaniter und Araber, die in den Wüsten südlich von Mesopotamien lebten. Wieder einmal wurde Babylon von den Assyrern belagert, hungerte aus, kapitulierte und seine Verbündeten wurden besiegt.
Ashurbanipal feierte einen „Gottesdienst der Versöhnung“, wagte es jedoch nicht, Bels „Hände zu ergreifen“. Ein assyrischer Gouverneur namens Kandalanu wurde zum Herrscher der Stadt ernannt. Ashurbanipal sammelte Texte aus Babylon, um sie in seine umfangreiche Bibliothek in Ninive aufzunehmen. Nach dem Tod von Ashurbanipal destabilisierte sich das assyrische Reich aufgrund einer Reihe interner Bürgerkriege während der Herrschaft der assyrischen Könige Ashur-etil-ilani, Sin-shumu-lishir und Sinsharishkun. Schließlich nutzte Babylon wie viele andere Teile des Nahen Ostens die Anarchie in Assyrien aus, um sich von der assyrischen Herrschaft zu befreien.
Im anschließenden Sturz des Assyrischen Reiches durch ein Völkerbündnis sahen die Babylonier ein weiteres Beispiel göttlicher Rache. Unter Nabopolassar, einem bisher unbekannten chaldäischen Häuptling, entkam Babylon der assyrischen Herrschaft und zerstörte im Bündnis mit Kyaxares, dem König der Meder und Perser, zusammen mit den Skythen und Kimmeriern schließlich das Assyrische Reich zwischen 612 v. Chr. und 605 v. Chr. Babylon wurde so zur Hauptstadt des neubabylonischen Reiches (manchmal und möglicherweise fälschlicherweise auch Chaldäisches Reich genannt). Mit der Wiederherstellung der babylonischen Unabhängigkeit begann eine new era architektonischer Aktivitäten, insbesondere während der Herrschaft seines Sohnes Nebukadnezar II. (604–561 v. Chr.).
Nebukadnezar ordnete den vollständigen Wiederaufbau des kaiserlichen Geländes, einschließlich der Etemenanki-Zikkurat, und den Bau des Ischtar-Tors an – des markantesten der acht Tore rund um Babylon. Eine Rekonstruktion des Ischtar-Tors befindet sich im Pergamonmuseum in Berlin. Nebukadnezar wird auch der Bau der Hängenden Gärten von Babylon zugeschrieben – eines der sieben Weltwunder der Antike –, die angeblich für seine heimwehkranke Frau Amyitis erbaut wurden. Ob die Gärten tatsächlich existierten, ist umstritten. Der deutsche Archäologe Robert Koldewey vermutete, dass er die Fundamente entdeckt hatte, doch viele Historiker sind sich über den Standort nicht einig.
Stephanie Dalley hat argumentiert, dass sich die hängenden Gärten tatsächlich in der assyrischen Hauptstadt Ninive befanden. Nebuchandnezar wird bekanntermaßen auch mit der babylonischen Verbannung der Juden in Verbindung gebracht, die das Ergebnis einer imperialen Befriedungstechnik war, die auch von den Assyrern angewandt wurde und bei der ethnische Gruppen in eroberten Gebieten massenhaft in die Hauptstadt deportiert wurden. Die chaldäische Herrschaft über Babylon währte nicht lange; Es ist nicht klar, ob Neriglissar und Labashi-Marduk Chaldäer oder einheimische Babylonier waren, und der letzte Herrscher Nabonidus (556–539 v. Chr.) und sein Mitregentsohn Belsazar waren Assyrer aus Harran.
Im Jahr 539 v. Chr. fiel das neubabylonische Reich in einem militärischen Gefecht, das als Schlacht von Opis bekannt war, an Kyros den Großen, den König von Persien. Babylons Mauern galten als undurchdringlich. Der einzige Weg in die Stadt führte durch eines ihrer vielen Tore oder durch den Euphrat. Unter Wasser wurden Metallgitter installiert, die es dem Fluss ermöglichten, durch die Stadtmauern zu fließen und gleichzeitig ein Eindringen zu verhindern. Die Perser entwickelten einen Plan, um über den Fluss in die Stadt einzudringen. Während eines babylonischen Nationalfestes leiteten Cyrus‘ Truppen den Euphrat flussaufwärts um, sodass Cyrus‘ Soldaten durch das abgesenkte Wasser in die Stadt eindringen konnten.
Die persische Armee eroberte die Randgebiete der Stadt, während die Mehrheit der Babylonier im Stadtzentrum nichts von dem Einbruch wusste. Der Bericht wurde von Herodot ausgearbeitet und wird auch in Teilen der hebräischen Bibel erwähnt. Herodot beschrieb auch einen Wassergraben, eine enorm hohe und breite Mauer, die mit Bitumen betoniert war und auf der sich Gebäude befanden, sowie hundert Tore zur Stadt. Er schreibt auch, dass die Babylonier Turbane und Parfüm tragen und ihre Toten in Honig begraben, dass sie rituelle Prostitution praktizieren und dass drei Stämme unter ihnen nichts als Fisch essen. Die hundert Tore können als Hinweis auf Homer angesehen werden.
Nach der Erklärung von Archibald Henry Sayce im Jahr 1883 wurde Herodots Bericht über Babylon größtenteils als griechische Folklore und nicht als authentische Reise nach Babylon angesehen. Dalley und andere haben kürzlich vorgeschlagen, Herodots Bericht noch einmal ernst zu nehmen. Laut 2. Chronik 36 der hebräischen Bibel erließ Cyrus später ein Dekret, das es gefangenen Menschen, darunter auch den Juden, erlaubte, in ihr eigenes Land zurückzukehren. Der auf dem Cyrus-Zylinder gefundene Text wird von Bibelwissenschaftlern traditionell als bestätigender Beweis für diese Politik angesehen, obwohl die Interpretation umstritten ist, da der Text nur mesopotamische Heiligtümer nennt, Juden, Jerusalem oder Judäa jedoch nicht erwähnt.
Unter Cyrus und dem späteren persischen König Darius I. wurde Babylon zur Hauptstadt der 9. Satrapie (Babylonien im Süden und Athura im Norden) sowie zu einem Zentrum des Lernens und des wissenschaftlichen Fortschritts. Im achämenidischen Persien wurden die alten babylonischen Künste der Astronomie und Mathematik wiederbelebt und babylonische Gelehrte fertigten Sternbildkarten an. Die Stadt wurde zur Verwaltungshauptstadt des Persischen Reiches und blieb über zwei Jahrhunderte lang bekannt. Es wurden viele wichtige archäologische Entdeckungen gemacht, die zu einem besseren Verständnis dieser Ära beitragen können.
Die frühen persischen Könige hatten versucht, die religiösen Zeremonien von Marduk aufrechtzuerhalten, doch unter der Herrschaft von Darius III. führten Überbesteuerung und die Belastung zahlreicher Kriege zu einem Verfall der wichtigsten Schreine und Kanäle Babylons und zur Destabilisierung der umliegenden Region. Es gab zahlreiche Aufstandsversuche und 522 v. Chr. (Nebukadnezar III.), 521 v. Chr. (Nebukadnezar IV.) und 482 v. Chr. (Bel-shimani und Shamash-eriba) erlangten einheimische babylonische Könige kurzzeitig ihre Unabhängigkeit zurück. Diese Aufstände wurden jedoch schnell niedergeschlagen und Babylon blieb zwei Jahrhunderte lang unter persischer Herrschaft, bis Alexander der Große im Jahr 331 v. Chr. einzog
Im Oktober 331 v. Chr. wurde Darius III., der letzte achämenidische König des Persischen Reiches, in der Schlacht von Gaugamela von den Streitkräften des altmazedonischen griechischen Herrschers Alexander dem Großen besiegt. Ein einheimischer Bericht über diese Invasion erwähnt eine Anordnung Alexanders, die Häuser seiner Bewohner nicht zu betreten. Unter Alexander blühte Babylon erneut als Zentrum der Wissenschaft und des Handels auf. Nach Alexanders Tod im Jahr 323 v. Chr. im Palast Nebukadnezars wurde sein Reich jedoch unter seinen Generälen, den Diadochen, aufgeteilt und bald begannen jahrzehntelange Kämpfe. Die ständigen Unruhen haben die Stadt Babylon praktisch geleert.
Eine Tafel aus dem Jahr 275 v. Chr. besagt, dass die Bewohner Babylons nach Seleukia transportiert wurden, wo ein Palast und ein Tempel (Esagila) gebaut wurden. Durch diese Deportation verlor Babylon als Stadt an Bedeutung, obwohl mehr als ein Jahrhundert später noch immer in seinem alten Heiligtum Opfer dargebracht wurden. Unter dem Parther- und Sassanidenreich wurde Babylon (wie Assyrien) neun Jahrhunderte lang, bis nach 650 n. Chr., eine Provinz dieser persischen Reiche. Es bewahrte seine eigene Kultur und seine eigenen Menschen, die verschiedene Aramäische Sprachen sprachen und ihr Heimatland weiterhin als Babylon bezeichneten.
Beispiele ihrer Kultur finden sich im babylonischen Talmud, in der gnostischen mandäischen Religion, im östlichen Ritus-Christentum und in der Religion des Propheten Mani. Das Christentum wurde im 1. und 2. Jahrhundert n. Chr. in Mesopotamien eingeführt und Babylon war bis lange nach der arabisch-islamischen Eroberung Sitz eines Bischofs der Kirche des Ostens. Mitte des 7. Jahrhunderts wurde Mesopotamien vom expandierenden muslimischen Reich überfallen und besiedelt, und es folgte eine Zeit der Islamisierung. Babylon wurde als Provinz aufgelöst und das Aramäische und das Christentum der Kirche des Ostens wurden schließlich an den Rand gedrängt.
Ibn Hauqal erwähnt im zehnten Jahrhundert ein kleines Dorf namens Babel; Nachfolgende Reisende beschreiben nur Ruinen. Babylon wird in mittelalterlichen arabischen Schriften als Ziegelquelle erwähnt, die angeblich in Städten von Bagdad bis Basra verwendet wurden. In vielen Fällen konnten europäische Reisende die Lage der Stadt nicht erkennen oder verwechselten Falludscha mit ihr. Der Reisende Benjamin von Tudela aus dem 12. Jahrhundert erwähnt Babylon, aber es ist nicht klar, ob er wirklich dorthin ging. Andere bezeichneten Bagdad als Babylon oder Neu-Babylon und beschrieben verschiedene Bauwerke in der Region als den Turmbau zu Babel. Pietro della Valle entdeckte die antike Stätte im 17. Jahrhundert und stellte fest, dass sowohl gebrannte als auch getrocknete, mit Bitumen zementierte Lehmziegel vorhanden waren. [Wikipedia].
ÜBERPRÜFEN: Hammurabi (auch bekannt als Khammurabi und Ammurapi) regierte 1792-1750 v. Chr.) war der sechste König der ersten amoritischen Dynastie von Babylon, übernahm den Thron von seinem Vater Sin-Muballit und erweiterte das Königreich, um das gesamte antike Mesopotamien zu erobern. Das Königreich Babylon umfasste nur die Städte Babylon, Kish, Sippar und Borsippa, als Hammurabi den Thron bestieg, aber durch eine Reihe militärischer Feldzüge, sorgfältiger Bündnisse, die nötigenfalls geschlossen und gebrochen wurden, und politischer Manöver hielt er die gesamte Region unter Kontrolle Er erlangte 1750 v. Chr. die babylonische Kontrolle und versuchte laut seinen eigenen Inschriften, Briefen und Verwaltungsdokumenten aus seiner Regierungszeit, das Leben derer zu verbessern, die unter seiner Herrschaft lebten.
Heutzutage ist er vor allem für sein Gesetzbuch bekannt, das zwar nicht das früheste Gesetzeskodex ist, aber als Vorbild für andere Kulturen diente und vermutlich die von hebräischen Schriftgelehrten erlassenen Gesetze, darunter auch die aus der Bibel, beeinflusst hat Buch Exodus. Hammurabis Kodex verkörperte das Gesetz der vergeltenden Gerechtigkeit, besser bekannt als „Auge um Auge und Zahn um Zahn“. Die Amoriter waren ein Nomadenvolk, das irgendwann vor dem 3. millennium v. Chr. von der Küstenregion Eber Nari (dem heutigen Syrien) durch Mesopotamien wanderte und 1984 v. Chr. in Babylon herrschte.
Der fünfte König der Dynastie, Sin-Muballit (reg. 1812–1793 v. Chr.), schloss viele öffentliche Bauprojekte erfolgreich ab, war jedoch nicht in der Lage, das Königreich zu erweitern oder mit der rivalisierenden Stadt Larsa im Süden zu konkurrieren. Larsa war das lukrativste Handelszentrum am Persischen Golf und die Gewinne aus diesem Handel bereicherten die Stadt und förderten die Expansion, sodass die meisten Städte im Süden unter Larsas Kontrolle standen. Sin-Muballit führte eine Streitmacht gegen Larsa an, wurde jedoch von ihrem König Rim Sin I. besiegt. Zu diesem Zeitpunkt ist unklar, was genau geschah, aber es scheint, dass Sin-Muballit gezwungen war, zugunsten seines Sohnes Hammurabi abzudanken.
Ob Rim Sin I dachte, dass Hammurabi eine geringere Bedrohung für Larsa darstellen würde, ist ebenfalls unbekannt, aber wenn ja, würde er eines Besseren belehrt werden. Der Historiker Durant schreibt: „Am Anfang der [babylonischen Geschichte] steht die mächtige Figur Hammurabis, Eroberer und Gesetzgeber während einer dreiundvierzigjährigen Herrschaft.“ Urzeitliche Siegel und Inschriften überliefern uns teilweise von ihm – einem Jüngling voller Feuer und Genialität, einem wahren Wirbelsturm im Kampf, der alle Rebellen zerschmettert, seine Feinde in Stücke schneidet, über unzugängliche Berge marschiert und nie einen Kampf verliert. Unter ihm wurden die kleinen verfeindeten Staaten des unteren Tals zu Einheit und Frieden gezwungen und durch ein historisches Gesetzbuch zu Ordnung und Sicherheit gezwungen.
Zunächst gab Hammurabi Rim Sin I keinen Grund zur Beunruhigung. Er begann seine Herrschaft mit der Zentralisierung und Straffung seiner Verwaltung, der Fortsetzung der Bauprogramme seines Vaters und der Vergrößerung und Erhöhung der Stadtmauern. Er führte sein berühmtes Gesetzbuch ein (ca. 1772 v. Chr.), achtete sorgfältig auf die Bedürfnisse der Menschen, verbesserte die Bewässerung der Felder und die Instandhaltung der Infrastrukturen der Städte unter seiner Kontrolle und baute gleichzeitig opulente Tempel für die Götter. Gleichzeitig ordnete er seine Truppen und plante seinen Feldzug in die südliche Region Mesopotamiens.
Der Historiker Bertman stellt fest, wie sich Hammurabis persönlicher Charakter zu Beginn seiner Herrschaft zu seinem Vorteil auswirkte: „Hammurabi war ein fähiger Administrator, ein geschickter Diplomat und ein kluger Imperialist, der geduldig bei der Verwirklichung seiner Ziele war.“ Als er den Thron bestieg, erließ er eine Proklamation, in der er den Menschen ihre Schulden erließ, und steigerte seine Popularität in den ersten fünf Jahren seiner Herrschaft weiter, indem er die Heiligtümer der Götter, insbesondere Marduk, Babylons Schutzpatron, gewissenhaft renovierte. Dann, nachdem seine Macht im eigenen Land gesichert und seine Streitkräfte gerüstet waren, begann er eine fünfjährige Reihe von Feldzügen gegen rivalisierende Staaten im Süden und Osten und erweiterte sein Territorium.“
Als die Elamiten von Osten her in die zentralen Ebenen Mesopotamiens eindrangen, verbündete sich Hammurabi mit Larsa, um sie zu besiegen. Nachdem dies erreicht war, brach er das Bündnis und eroberte schnell die Städte Uruk und Isin, die zuvor von Larsa gehalten wurden, indem er Bündnisse mit anderen Stadtstaaten wie Nippur und Lagash schloss. Die Bündnisse, die er mit anderen Staaten geschlossen hatte, wurden immer wieder gebrochen, wenn der König es für notwendig hielt, aber da die Herrscher weiterhin Pakte mit Hammurabi eingingen, schien es keinem von ihnen in den Sinn gekommen zu sein, dass er dasselbe tun würde zu ihnen, wie er es zuvor zu anderen getan hatte.
Nachdem Uruk und Isin erobert waren, wandte er sich um und eroberte Nippur und Lagash und eroberte dann Larsa. Eine Technik, die er in diesem Gefecht offenbar zuerst angewendet hatte, wurde in anderen Fällen zu seiner bevorzugten Methode, wenn die Umstände es erlaubten: das Aufstauen von Wasserquellen in der Stadt, um sie dem Feind bis zur Kapitulation vorzuenthalten, oder möglicherweise das Zurückhalten des Wassers durch einen Damm und Dann ließ er sie frei, um die Stadt zu überfluten, bevor er dann einen Angriff startete. Dies war eine Methode, die zuvor von Hammurabis Vater angewendet wurde, jedoch mit deutlich geringerer Wirksamkeit. Larsa war die letzte Festung von Rim Sin und nach seinem Fall gab es keine andere Macht mehr, die dem König von Babylon im Süden standhalten konnte.
Nachdem der südliche Teil Mesopotamiens unter Kontrolle war, wandte sich Hammurabi nach Norden und Westen. Das amoritische Königreich Mari in Syrien war lange Zeit ein Verbündeter des amoritischen Babylon, und Hammurabi unterhielt freundschaftliche Beziehungen zum König Zimri-Lim (reg. 1755–1761 v. Chr.). Zimri-Lim hatte erfolgreiche Feldzüge durch den Norden Mesopotamiens geführt und aufgrund des durch diese Siege erwirtschafteten Reichtums wurde Mari zum Neid anderer Städte mit einem der größten und opulentesten Paläste der Region.
Wissenschaftler haben lange darüber diskutiert, warum Hammurabi sein Bündnis mit Simri-Lim brechen sollte, aber der Grund scheint ziemlich klar: Mari war ein wichtiges, luxuriöses und wohlhabendes Handelszentrum am Euphrat und besaß große Reichtümer und natürlich Wasserrechte. Die Stadt direkt zu halten, anstatt über Ressourcen verhandeln zu müssen, wäre für jeden Herrscher vorzuziehen, und das war sicherlich auch für Hammurabi der Fall. Er griff Mari 1761 v. Chr. schnell an und zerstörte es aus irgendeinem Grund, anstatt es einfach zu erobern. Das ist ein viel größeres Rätsel als die Frage, warum er überhaupt dagegen vorging.
Andere eroberte Städte wurden in das Königreich eingegliedert und dann repariert und verbessert. Warum Mari eine solche Ausnahme von Hammurabis Herrschaft darstellte, wird von Gelehrten immer noch diskutiert, aber der Grund könnte so einfach sein, dass Hammurabi Babylon zur größten der mesopotamischen Städte machen wollte und Mari ein klarer Rivale um diese Ehre war. Es wird angenommen, dass Zimri-Lim bei diesem Gefecht getötet wurde, da er im selben Jahr aus den historischen Aufzeichnungen verschwindet. Von Mari aus marschierte Hammurabi nach Ashur und eroberte die Region Assyrien und schließlich Eshnunna (ebenfalls durch Stauung des Wassers erobert), sodass er 1755 v. Chr. ganz Mesopotamien beherrschte.
Obwohl Hammurabi viel Zeit im Feldzug verbrachte, stellte er sicher, dass er für die Menschen sorgte, über deren Ländereien er herrschte. Ein beliebter Titel, der Hammurabi zu seinen Lebzeiten verliehen wurde, war bani matim, „Erbauer des Landes“, wegen der vielen Bauprojekte und Kanäle, die er in der gesamten Region errichten ließ. Dokumente aus dieser Zeit belegen die Wirksamkeit von Hammurabis Herrschaft und seinen aufrichtigen Wunsch, das Leben der Menschen in Mesopotamien zu verbessern. Diese Briefe und Verwaltungsdokumente (z. B. Anweisungen für den Bau von Kanälen, die Verteilung von Nahrungsmitteln, Verschönerungs- und Bauprojekte sowie rechtliche Fragen) stützen die Ansicht, die Hammurabi über sich selbst vertrat. Der Prolog zu seinem berühmten Gesetzbuch beginnt:
„Als der erhabene Anu, König der Annunaki und Bel, Herr des Himmels und der Erde, der das Schicksal des Landes bestimmt, Marduk die Herrschaft über die gesamte Menschheit anvertraute, als sie den erhabenen Namen Babylon aussprachen, als sie es erschufen berühmt in allen Teilen der Welt und errichtete in seiner Mitte ein ewiges Königreich, dessen Fundamente fest waren wie Himmel und Erde – damals nannten mich Anu und Bel Hammurabi, den erhabenen Prinzen, den Anbeter der Götter, um der Gerechtigkeit die Oberhand zu geben im Land, um die Bösen und Bösen zu vernichten, um zu verhindern, dass die Starken die Schwachen unterdrücken, um das Land zu erleuchten und das Wohlergehen des Volkes zu fördern. Hammurabi, der von Bel benannte Statthalter, bin ich, der Fülle und Überfluss geschaffen hat.“
Sein berühmtes Gesetzbuch ist nicht das erste derartige Gesetzbuch in der Geschichte (obwohl es oft so genannt wird), sondern sicherlich das berühmteste aus der Antike vor dem in den biblischen Büchern niedergelegten Gesetzbuch. Der Kodex von Ur-Nammu (ca. 2100–2050 v. Chr.), der entweder von Ur-Nammu oder seinem Sohn Schulgi von Ur stammt, ist der älteste Gesetzeskodex der Welt. Hammurabis Kodex unterschied sich in wesentlichen Punkten von den früheren Gesetzen. Der Historiker Kriwaczek erklärt dies, indem er schreibt:
„Hammurabis Gesetze spiegeln den Schock eines beispiellosen sozialen Umfelds wider: der multiethnischen, multistämmigen babylonischen Welt. In früheren sumerisch-akkadischen Zeiten hatten sich alle Gemeinschaften als gemeinsame Mitglieder derselben Familie gefühlt, alle gleichermaßen Diener unter den Augen der Götter. Unter solchen Umständen könnten Streitigkeiten durch den Rückgriff auf ein kollektiv akzeptiertes Wertesystem beigelegt werden, in dem Blut dicker als Wasser und eine gerechte Wiedergutmachung wünschenswerter als Rache sei. Als nun jedoch städtische Bürger häufig mit Nomaden zusammentrafen, die einer völlig anderen Lebensweise folgten, als Sprecher mehrerer westsemitischer Amurru-Sprachen und anderer Sprachen mit verständnislosen Akkadiern zusammenkamen, musste die Konfrontation nur allzu leicht übergeschwappt sein Konflikt. Vendetten und Blutfehden müssen den Zusammenhalt des Reiches oft bedroht haben.
Der Kodex von Ur-Nammu stützt sich sicherlich auf das Konzept „gemeinsamer Mitglieder derselben Familie“, da durchgehend von einem grundlegenden Verständnis der Menschen über angemessenes Verhalten in der Gesellschaft ausgegangen wird. Von jedem, der dem Gesetz unterstand, wurde erwartet, dass er bereits wusste, was die Götter von ihm verlangten, und vom König wurde lediglich erwartet, dass er den Willen des Gottes ausführte. Wie die Historikerin Karen Rhea Nemet-Najat schreibt: „Der König war direkt verantwortlich für die Rechtsprechung im Namen der Götter, die im Universum für Recht und Ordnung gesorgt hatten.“
Hammurabis Kodex wurde zu einer späteren Zeit geschrieben, als das Verständnis eines Stammes oder einer Stadt vom Willen der Götter möglicherweise anders war als das eines anderen. Um die Sache zu vereinfachen, versuchte Hammurabis Kodex Rachefeldzüge und Blutfehden zu verhindern, indem er das Verbrechen – und die Strafe, die der Staat für die Begehung eines solchen Verbrechens verhängen würde – klar darlegte, ohne ein gemeinsames Verständnis des Willens Gottes in diesen Angelegenheiten vorauszusetzen: „Wenn …“ Wenn jemand einem anderen das Auge aussticht, soll ihm das Auge ausgestochen werden. Wenn er einem anderen den Knochen bricht, soll sein Knochen gebrochen werden. Wenn ein Mann einem seinesgleichen die Zähne ausschlägt, sollen ihm die Zähne ausgeschlagen werden. Wenn ein Baumeister für jemanden ein Haus baut und es nicht richtig baut und das Haus, das er gebaut hat, einstürzt und seinen Besitzer tötet, dann soll dieser Baumeister getötet werden. Wenn es den Sohn des Hausbesitzers tötet, soll der Sohn dieses Erbauers getötet werden.“
Anders als der frühere Kodex von Ur-Nammu, der Bußgelder oder Landstrafen verhängte, verkörperte Hammurabis Kodex das als Lex Talionis bekannte Prinzip, das Gesetz der vergeltenden Gerechtigkeit, in dem die Strafe direkt dem Verbrechen entspricht, besser bekannt als das Konzept von „an“. „Auge um Auge und Zahn um Zahn“, bekannt aus dem späteren Gesetzeskodex des Alten Testaments, veranschaulicht in dieser Passage aus dem Buch Exodus: „Wenn Menschen kämpfen und eine schwangere Frau schlagen und sie ein Frühchen zur Welt bringt Liegt keine ernsthafte Verletzung vor, muss dem Täter eine Geldstrafe auferlegt werden, was auch immer der Ehemann der Frau verlangt und das Gericht zulässt. Wenn aber ein schwerer Schaden vorliegt, sollt ihr Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandwunde um Brandwunde, Wunde um Wunde, Beule um Beule nehmen“ (2. Mose 21,22-25). ).
Hammurabis Gesetzbuch legte somit den Standard für künftige Gesetze fest, indem es strikt mit den Beweisen des Verbrechens umging und eine spezifische Strafe für dieses Verbrechen festlegte. Was jedoch über Schuld oder Unschuld entschied, war die viel ältere Methode der Tortur, bei der eine beschuldigte Person dazu verurteilt wurde, eine bestimmte Aufgabe auszuführen (normalerweise in einen Fluss geworfen zu werden oder eine bestimmte Strecke über einen Fluss schwimmen zu müssen) und Wenn es ihnen gelang, waren sie unschuldig, und wenn nicht, waren sie schuldig. Hammurabis Kodex besagt: „Wenn die Frau eines Mannes wegen eines anderen Mannes angezeigt wird, obwohl sie nicht mit ihm erwischt wurde, muss sie sich um ihres Mannes willen in den göttlichen Fluss stürzen.“
Die Frau, die dies tat und die Tortur überlebte, wurde als unschuldig anerkannt, aber dann wurde ihr Ankläger wegen falscher Aussage für schuldig befunden und mit dem Tod bestraft. Bei den schwersten Verbrechen, Ehebruch und Zauberei, wurde regelmäßig auf die Tortur zurückgegriffen, da man davon ausging, dass diese beiden Verstöße die soziale Stabilität am ehesten untergraben würden. Für einen alten Mesopotamier hatte Zauberei nicht genau die gleiche Definition wie heute, sondern würde sich auf die Ausführung von Handlungen beziehen, die gegen den bekannten Willen der Götter verstießen – Handlungen, die die Art von Macht auf einen selbst widerspiegelten und Prestige, auf das nur die Götter Anspruch erheben konnten.
Geschichten über böse Zauberer und Zauberinnen finden sich in vielen Perioden der mesopotamischen Geschichte, und die Autoren dieser Geschichten berichten immer davon, dass sie ein schlechtes Ende nehmen würden, wie es anscheinend auch bei ihnen der Fall war, als sie der Tortur ausgesetzt waren. Als Hammurabi 1755 v. Chr. der unangefochtene Herrscher Mesopotamiens war, war er alt und krank. In den letzten Jahren seines Lebens hatte sein Sohn Samsu-Iluna bereits die Verantwortung für den Thron übernommen und 1749 v. Chr. die volle Herrschaft übernommen. Die Eroberung von Eshnunna hatte eine Barriere im Osten beseitigt, die die Region vor Einfällen von Menschen geschützt hatte wie die Hethiter und Kassiten.
Als diese Barriere verschwunden war und sich die Nachricht von der Schwächung des großen Königs verbreitete, bereiteten die östlichen Stämme ihre Armeen auf eine Invasion vor. Hammurabi starb 1750 v. Chr. und Samsu-Iluna blieb zurück, um das Reich seines Vaters gegen die Invasionstruppen zu verteidigen und gleichzeitig die verschiedenen Regionen Babyloniens unter der Kontrolle der Stadt Babylon zu halten. Es war eine gewaltige Aufgabe, der er nicht gewachsen war. Das riesige Königreich, das Hammurabi zu seinen Lebzeiten aufgebaut hatte, begann bereits ein Jahr nach seinem Tod zu zerfallen, und die Städte, die einst Teil von Vasallenstaaten gewesen waren, sicherten ihre Grenzen und verkündeten ihre Autonomie.
Keiner von Hammurabis Nachfolgern konnte das Königreich wieder aufbauen, und zuerst fielen die Hethiter (1595 v. Chr.), dann die Kassiten ein. Die Hethiter plünderten Babylon und die Kassiten bewohnten es und benannten es um. Die Elamiten, die vor Jahrzehnten von Hammurabi völlig besiegt worden waren, fielen ein und entführten die Stele von Hammurabis Gesetzbuch, die 1902 n. Chr. in der elamitischen Stadt Susa entdeckt wurde. Hammurabi ist heute am besten als Gesetzesgeber in Erinnerung, dessen Gesetzbuch als diente Standard für spätere Gesetze, aber zu seiner Zeit war er als der Herrscher bekannt, der Mesopotamien unter einem einzigen Regierungsorgan vereinte, so wie es Sargon der Große von Akkad Jahrhunderte zuvor getan hatte.
Er verband sich mit großen Imperialisten wie Sargon dem Großen, indem er sich selbst zum „mächtigen König, König von Babylon, König der vier Regionen der Welt, König von Sumer und Akkad, in dessen Macht der Gott Bel Land und Leute gegeben hat, In dessen Hand er die Zügel der Regierung gelegt hat“ und behauptete, genau wie Sargon (und andere), dass seine legitime Herrschaft durch den Willen der Götter bestimmt sei. Im Gegensatz zu Sargon dem Großen, dessen multiethnisches Reich jedoch ständig von mörderischen Auseinandersetzungen zerrissen wurde, herrschte Hammurabi über ein Königreich, dessen Volk nach seiner Eroberung relativen Frieden genoss.
Die Historikerin Gwendolyn Leick schreibt: „Hammurabi bleibt einer der großen Könige Mesopotamiens, ein herausragender Diplomat und Unterhändler, der geduldig genug war, um auf den richtigen Zeitpunkt zu warten, und dann rücksichtslos genug, um seine Ziele zu erreichen, ohne seine Ressourcen zu sehr zu strapazieren.“ Es ist ein Zeugnis seiner Herrschaft, dass Hammurabi im Gegensatz zu Sargon von Akkad oder seinem Enkel Naram-Sin aus früheren Zeiten Städte und Regionen nicht wiederholt zurückerobern musste, sondern sie größtenteils unter babylonische Herrschaft brachte , die daran interessiert sind, sie und den Lebensstandard der Einwohner zu verbessern (eine bemerkenswerte Ausnahme ist natürlich Mari). Sein Vermächtnis als Gesetzgeber spiegelt sein echtes Anliegen für soziale Gerechtigkeit und die Verbesserung des Lebens seines Volkes wider. [Enzyklopädie der antiken Geschichte]
ÜBERPRÜFEN: Das bekannteste und einflussreichste mesopotamische Gesetzbuch war das von König Hammurabi von Babylonien (reg. 1792–1750 v. Chr.). Mit fast 300 Bestimmungen, die Themen von Ehe und Erbschaft bis hin zu Diebstahl und Mord abdecken, ist es das umfassendste dieser Kodizes. Während es bekanntermaßen Vergeltungsklauseln enthält, bei denen es um den Grundsatz „Auge um Auge“ geht, geht es auch um komplexere Szenarien und verhängt harte Strafen für Anschuldigungen ohne Beweise und für Fehler von Richtern. Der Code erscheint in absichtlich archaischer Keilschrift auf einer gewaltigen, siebeneinhalb Fuß hohen Dioritstele, die aus Susa im heutigen Iran geborgen wurde, wohin sie nach einem Diebstahl im 12. Jahrhundert v. Chr. gebracht wurde
Diese Stele und ähnliche Stelen zeigen im oberen Teil ein Relief, das zeigt, wie Hammurabi die göttliche Sanktion des Sonnengottes Schamasch erhält. Sie wurden während der Herrschaft Hammurabis und noch lange danach öffentlich ausgestellt. „Der Kodex wurde sicherlich auf Stadtplätzen, in Tempelhöfen und an öffentlichen Orten aufgestellt – wo er von der Bevölkerung gesehen wurde“, sagt Martha Roth, Assyriologin an der University of Chicago. Es wurde auch mindestens 1.000 Jahre nach seiner Entstehung in der Ausbildung von Schriftgelehrten verwendet, und mehrere Manuskripte davon wurden in der Bibliothek von König Ashurbanipal (reg. 668–627 v. Chr.) aus dem 7. Jahrhundert v. Chr. in Ninive im heutigen Irak gefunden.
Die genaue rechtliche Funktion von Hammurabis Kodex ist unklar, da es in juristischen Aufzeichnungen aus seiner Zeit nur wenige Hinweise darauf gibt. Allerdings, sagt Roth, deuten diese Aufzeichnungen darauf hin, dass „die in Hammurabi dargelegten Bestimmungen der täglichen Realität ziemlich genau entsprechen“. Der Kodex zielte auch eindeutig darauf ab, Hammurabi zum Garanten der Gerechtigkeit für sein Volk zu machen. „Damit die Mächtigen den Schwachen kein Unrecht tun, um den Waisen und Witwen gerechte Wege zu bieten“, heißt es im Epilog, „habe ich meine kostbaren Verkündigungen in meine Stele eingraviert.“
Dieses Bild des Königs als Beschützer der Unterdrückten erscheint regelmäßig in mesopotamischen Inschriften, aber das früheste bekannte Beispiel findet sich auf mehreren Kegeltafeln, die als Reformen von Urukagina (r. ca. Chr.), ein König des sumerischen Stadtstaates Lagasch im heutigen Irak. Den Inschriften zufolge ging der König auf eine Reihe sozialer Ungerechtigkeiten ein, darunter die Einschränkung der Macht gieriger Tempelaufseher und missbräuchlicher Vorarbeiter. „Da steckt ein Reformbewusstsein drin, das bisher einmalig ist“, sagt Roth, „und in der Geschichte kommt es hier zum ersten Mal zustande.“ [Archäologisches Institut von Amerika].
ÜBERPRÜFEN: Hammurabi (ca. 1810 v. Chr. – 1750 v. Chr.) war der sechste König der ersten babylonischen Dynastie und regierte von 1792 v. Chr. bis 1750 v. Chr. (gemäß der Mittleren Chronologie). Ihm vorausgegangen war sein Vater Sin-Muballit, der aus gesundheitlichen Gründen abdankte. Durch militärische Feldzüge weitete er die Kontrolle Babylons über ganz Mesopotamien aus. Hammurabi ist für den Kodex von Hammurabi bekannt, einen der frühesten erhaltenen Gesetzeskodizes in der aufgezeichneten Geschichte, den er angeblich von Schamasch, dem babylonischen Gott der Gerechtigkeit, erhalten hat.
Im Gegensatz zu früheren sumerischen Gesetzbüchern, die sich auf die Entschädigung des Opfers des Verbrechens konzentrierten, war das Gesetz von Hammurabi eines der ersten Gesetzbücher, das einen größeren Schwerpunkt auf die körperliche Bestrafung des Täters legte. Trotz der Ähnlichkeiten zwischen dem Kodex von Hammurabi und dem Gesetz Moses in der Thora ist es unwahrscheinlich, dass Hammurabis Gesetze irgendeinen direkten Einfluss auf die späteren mosaischen Gesetze hatten. Der Name Hammurabi leitet sich vom amoritischen Begriff ʻAmmurāpi („der Verwandte ist ein Heiler“) ab, der wiederum von ʻAmmu („väterlicher Verwandter“) und Rāpi („Heiler“) stammt. Babylon war einer der vielen größtenteils von Amoriten regierten Stadtstaaten, die über die Ebenen Zentral- und Südmesopotamiens verstreut waren und gegeneinander Krieg führten, um die Kontrolle über fruchtbares Agrarland zu erlangen.
Obwohl in Mesopotamien viele Kulturen nebeneinander existierten, erlangte die babylonische Kultur unter Hammurabi unter den gebildeten Klassen im gesamten Nahen Osten eine gewisse Bedeutung. Die Könige vor Hammurabi hatten 1894 v. Chr. einen relativ kleinen Stadtstaat gegründet, der nur wenige Gebiete außerhalb der Stadt selbst kontrollierte. Babylon stand nach seiner Gründung etwa ein Jahrhundert lang im Schatten älterer, größerer und mächtigerer Königreiche wie Elam, Assyrien, Isin, Eshnunna und Larsa. Sein Vater Sin-Muballit hatte jedoch begonnen, die Herrschaft über ein kleines Gebiet im südlichen Zentralmesopotamien unter babylonischer Hegemonie zu festigen, und hatte zum Zeitpunkt seiner Herrschaft die kleineren Stadtstaaten Borsippa, Kish und Sippar erobert.
So bestieg Hammurabi den Thron als König eines kleinen Königreichs inmitten einer komplexen geopolitischen Situation. Das mächtige Königreich Eshnunna kontrollierte den oberen Tigris, während Larsa das Flussdelta kontrollierte. Östlich von Mesopotamien lag das mächtige Königreich Elam, das regelmäßig in die kleinen Staaten im Süden Mesopotamiens einfiel und ihnen Tribut aufzwang. Im nördlichen Mesopotamien hatte der assyrische König Shamshi-Adad I., der bereits jahrhundertealte assyrische Kolonien in Kleinasien geerbt hatte, sein Territorium in die Levante und Zentralmesopotamien ausgedehnt, obwohl sein früher Tod sein Reich etwas fragmentieren würde.
Die ersten Jahrzehnte der Herrschaft Hammurabis verliefen recht friedlich. Hammurabi nutzte seine Macht, um eine Reihe öffentlicher Arbeiten durchzuführen, darunter die Erhöhung der Stadtmauern zu Verteidigungszwecken und die Erweiterung der Tempel. Um 1801 v. Chr. drang das mächtige Königreich Elam, das wichtige Handelsrouten über das Zagros-Gebirge erstreckte, in die mesopotamische Ebene ein. Mit Verbündeten unter den Ebenenstaaten griff Elam das Königreich Eshnunna an und zerstörte es, zerstörte eine Reihe von Städten und erzwang seine Herrschaft zum ersten Mal über Teile der Ebene.
Um seine Position zu festigen, versuchte Elam, einen Krieg zwischen Hammurabis babylonischem Königreich und dem Königreich Larsa zu beginnen. Hammurabi und der König von Larsa schlossen ein Bündnis, als sie diese Doppelzüngigkeit entdeckten, und konnten die Elamiten vernichten, obwohl Larsa keinen großen Beitrag zu den militärischen Bemühungen leistete. Verärgert über Larsas Versäumnis, ihm zu Hilfe zu kommen, wandte sich Hammurabi gegen diese südliche Macht und erlangte so um 1763 v. Chr. die Kontrolle über die gesamte untere mesopotamische Ebene
Da Hammurabi während des Krieges im Süden von seinen Verbündeten aus dem Norden wie Yamhad und Mari unterstützt wurde, führte die Abwesenheit von Soldaten im Norden zu Unruhen. Hammurabi setzte seine Expansion fort und richtete seine Aufmerksamkeit nach Norden, um die Unruhen zu unterdrücken und kurz darauf Eshnunna zu vernichten. Als nächstes eroberten die babylonischen Armeen die verbleibenden nördlichen Staaten, einschließlich Babylons ehemaligem Verbündeten Mari, obwohl es möglich ist, dass die Eroberung Maris eine Kapitulation ohne tatsächlichen Konflikt war.
Hammurabi begann einen langwierigen Krieg mit Ishme-Dagan I. von Assyrien um die Kontrolle über Mesopotamien, wobei beide Könige Bündnisse mit kleineren Staaten eingingen, um die Oberhand zu gewinnen. Schließlich setzte sich Hammurabi durch und verdrängte Ishme-Dagan I. kurz vor seinem eigenen Tod. Mut-Ashkur, der neue König von Assyrien, war gezwungen, Hammurabi Tribut zu zahlen, Babylon regierte Assyrien jedoch nicht direkt. In nur wenigen Jahren gelang es Hammurabi, ganz Mesopotamien unter seiner Herrschaft zu vereinen.
Das assyrische Königreich überlebte, war jedoch während seiner Herrschaft gezwungen, Tribut zu zahlen, und von den großen Stadtstaaten in der Region behielten nur Aleppo und Qatna im Westen in der Levante ihre Unabhängigkeit. Eine Stele von Hammurabi wurde jedoch bis nach Diyarbekir gefunden, wo er den Titel „König der Amoriter“ beansprucht. Es wurden zahlreiche Vertragstafeln entdeckt, die auf die Regierungszeit Hammurabis und seiner Nachfolger datiert sind, sowie 55 seiner eigenen Briefe.
Diese Briefe geben einen Einblick in die täglichen Prüfungen der Herrschaft über ein Imperium, vom Umgang mit Überschwemmungen und der Anordnung von Änderungen an einem fehlerhaften Kalender bis hin zur Pflege der riesigen Viehherden Babylons. Hammurabi starb und übergab die Herrschaft über das Reich etwa 1750 v. Chr. an seinen Sohn Samsu-iluna, unter dessen Herrschaft das babylonische Reich schnell zu zerfallen begann. Der Kodex von Hammurabi wurde auf einer Stele eingraviert und an einem öffentlichen Ort aufgestellt, damit ihn jeder sehen konnte, obwohl man annimmt, dass nur wenige lesen und schreiben konnten. Die Stele wurde später von den Elamitern geplündert und in ihre Hauptstadt Susa gebracht; Es wurde dort 1901 n. Chr. im Iran wiederentdeckt und befindet sich heute im Louvre-Museum in Paris.
Der Kodex von Hammurabi enthält 282 Gesetze, die von Schriftgelehrten auf 12 Tafeln geschrieben wurden. Im Gegensatz zu früheren Gesetzen war es in Akkadisch, der Alltagssprache Babylons, verfasst und konnte daher von jeder gebildeten Person in der Stadt gelesen werden. Frühere sumerische Gesetze konzentrierten sich auf die Entschädigung des Opfers des Verbrechens, doch das Gesetzbuch von Hammurabi konzentrierte sich stattdessen auf die körperliche Bestrafung des Täters. Der Kodex von Hammurabi war einer der ersten Gesetzestexte, der Beschränkungen dafür vorsah, was einer geschädigten Person als Vergeltung gestattet wurde.
Die Struktur des Kodex ist sehr spezifisch, wobei jede Straftat eine bestimmte Strafe erhält. Die Strafen waren nach modernen Maßstäben in der Regel sehr hart, wobei viele Straftaten den Tod, eine Entstellung oder die Anwendung der Philosophie „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ (Lex Talionis „Gesetz der Vergeltung“) zur Folge hatten. Der Kodex ist auch eines der frühesten Beispiele für die Idee der Unschuldsvermutung und legt außerdem nahe, dass Angeklagter und Ankläger die Möglichkeit haben, Beweise vorzulegen. Mildernde Umstände zur Abänderung der Strafe sind jedoch nicht vorgesehen.
Eine Schnitzerei an der Spitze der Stele stellt Hammurabi dar, wie er die Gesetze von Schamasch, dem babylonischen Gott der Gerechtigkeit, erhält, und im Vorwort heißt es, dass Hammurabi von Schamasch ausgewählt wurde, um die Gesetze dem Volk zu bringen. Parallelen zwischen dieser Erzählung und der Übergabe des Bundeskodex an Moses durch Jahwe auf dem Berg Sinai im biblischen Buch Exodus und Ähnlichkeiten zwischen den beiden Rechtskodizes lassen auf einen gemeinsamen Vorfahren im semitischen Hintergrund der beiden schließen. Dennoch wurden Fragmente früherer Gesetzeskodizes gefunden und es ist unwahrscheinlich, dass die mosaischen Gesetze direkt vom Kodex Hammurabis inspiriert wurden.
Einige Gelehrte haben dies bestritten; David P. Wright argumentiert, dass der Jewish Covenant Code „unmittelbar, in erster Linie und vollständig“ auf den Gesetzen von Hammurabi basiert. Im Jahr 2010 entdeckte ein Team von Archäologen der Hebräischen Universität in Hazor in Israel eine Keilschrifttafel aus dem 18. oder 17. Jahrhundert v. Chr., die Gesetze enthielt, die eindeutig aus dem Kodex von Hammurabi abgeleitet waren. Ähnliche Gesetzeskodizes wurden in mehreren benachbarten Zivilisationen geschaffen, darunter die früheren mesopotamischen Beispiele des Ur-Nammu-Gesetzes, die Gesetze von Eshnunna und das Gesetzbuch von Lipit-Ishtar sowie das spätere hethitische Gesetzbuch.
Während der Herrschaft Hammurabis übernahm Babylon von seinem Vorgänger Nippur die Position der „heiligsten Stadt“ im Süden Mesopotamiens. Unter der Herrschaft von Hammurabis Nachfolger Samsu-iluna begann das kurzlebige Babylonische Reich zusammenzubrechen. In Nordmesopotamien wurden sowohl die Amoriter als auch die Babylonier um 1740 v. Chr. von Puzur-Sin, einem einheimischen akkadischsprachigen Herrscher, aus Assyrien vertrieben. Etwa zur gleichen Zeit warfen akkadischsprachige Muttersprachler die amoritisch-babylonische Herrschaft im äußersten Süden Mesopotamiens ab und schufen das Seeland Dynastie, mehr oder weniger in der Region des antiken Sumer.
Hammurabis erfolglose Nachfolger erlitten weitere Niederlagen und Gebietsverluste durch assyrische Könige wie Adasi und Bel-ibni sowie durch die Sealand-Dynastie im Süden, Elam im Osten und die Kassiten aus dem Nordosten. So wurde Babylon schnell auf den kleinen und unbedeutenden Staat reduziert, der es einst bei seiner Gründung gewesen war. Der Gnadenstoß für die Amoriter-Dynastie der Hammurabi ereignete sich im Jahr 1595 v. Chr., als Babylon vom mächtigen Hethiterreich geplündert und erobert wurde und damit jegliche politische Präsenz der Amoriter in Mesopotamien beendet wurde.
Die indoeuropäisch sprechenden Hethiter blieben jedoch nicht und übergaben Babylon an ihre kassitischen Verbündeten, ein Volk, das eine isolierte Sprache aus der Region des Zagros-Gebirges sprach. Diese Kassiten-Dynastie regierte Babylon über 400 Jahre lang und übernahm viele Aspekte der babylonischen Kultur, einschließlich Hammurabis Gesetzeskodex. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts glaubten viele Gelehrte, dass Hammurabi Amraphel, der König von Schinar, im Buch Genesis 14:1 sei. Diese Ansicht wurde inzwischen weitgehend abgelehnt, und die Existenz Amraphaels wird in keinen Schriften außerhalb der Bibel bestätigt.
Da Hammurabi einen Ruf als Gesetzgeber genießt, ist seine Darstellung in mehreren US-Regierungsgebäuden zu finden. Hammurabi ist einer der 23 Gesetzgeber, die in Marmorreliefs im Plenarsaal des US-Repräsentantenhauses im Kapitol der Vereinigten Staaten abgebildet sind. An der Südwand des Gebäudes des Obersten Gerichtshofs der USA befindet sich ein Fries von Adolph Weinman, der die „großen Gesetzgeber der Geschichte“, darunter Hammurabi, darstellt. Zur Zeit von Saddam Hussein wurde die 1. Hammurabi-Panzerdivision der irakischen Armee nach dem alten König benannt, um die Verbindung zwischen dem modernen Irak und den vorarabischen mesopotamischen Kulturen hervorzuheben. [Wikipedia].
ÜBERPRÜFEN: Gilgamesch ist der halbmythische König von Uruk, der vor allem aus dem Gilgamesch-Epos (geschrieben um 2150-1400 v. Chr.) bekannt ist, dem großen sumerisch-babylonischen poetischen Werk, das 1500 Jahre älter als Homers Schrift ist und daher als das älteste Werk gilt der epischen westlichen Literatur. Gilgameschs Vater war der Priesterkönig Lugalbanda (der in zwei Gedichten über seine magischen Fähigkeiten vor Gilgamesch erwähnt wird) und seine Mutter die Göttin Ninsun (die Heilige Mutter und Große Königin), und dementsprechend war Gilgamesch ein Halbgott Er soll ein außergewöhnlich langes Leben gelebt haben (in der sumerischen Königsliste wird seine Regierungszeit mit 126 Jahren angegeben) und übermenschliche Kräfte gehabt haben.
Im Sumerischen als „Bilgames“ und im Griechischen als „Gilgamos“ bekannt und eng mit der Figur von Dumuzi aus dem sumerischen Gedicht „Der Abstieg der Inanna“ verbunden, gilt Gilgamesch weithin als der historische fünfte König von Uruk, dessen Einfluss so tiefgreifend war, dass Mythen entstanden sind Sein göttlicher Status wuchs rund um seine Taten und gipfelte schließlich in den Geschichten im Gilgamesch-Epos. In der sumerischen Geschichte von Inanna und dem Huluppu-Baum, in der die Göttin Inanna in ihrem Garten einen störenden Baum pflanzt und ihre Familie um Hilfe bittet, erscheint Gilgamesch als ihr treuer Bruder, der ihr zu Hilfe kommt.
In dieser Geschichte pflanzt Inanna (die Göttin der Liebe und des Krieges und eine der mächtigsten und beliebtesten Gottheiten Mesopotamiens) einen Baum in ihrem Garten in der Hoffnung, eines Tages daraus einen Stuhl und ein Bett zu machen. Der Baum wird jedoch von einer Schlange an seinen Wurzeln, einem weiblichen Dämon (Lilitu) in seiner Mitte und einem Anzu-Vogel in seinen Zweigen befallen. Wie auch immer, Inanna kann sich von den Schädlingen nicht befreien und bittet deshalb ihren Bruder Utu, den Gott der Sonne, um Hilfe. Utu weigert sich, aber ihr Flehen wird von Gilgamesch erhört, der schwer bewaffnet kommt und die Schlange tötet.
Der Dämon und der Anzu-Vogel fliehen daraufhin, und nachdem Gilgamesch die Zweige für sich genommen hat, überreicht er Inanna den Stamm, aus dem sie ihr Bett und ihren Stuhl bauen kann. Es wird angenommen, dass dies Gilgameschs erster Auftritt in der Heldendichtung ist, und die Tatsache, dass er eine mächtige und mächtige Göttin aus einer schwierigen Situation rettet, zeigt die hohe Wertschätzung, die ihm schon früh entgegengebracht wurde. Dem historischen König wurde schließlich der völlig göttliche Status als Gott zuerkannt. Er galt als Bruder von Inanna, einer der beliebtesten Göttinnen, wenn nicht sogar der beliebtesten, in ganz Mesopotamien.
Auf Tontafeln gefundene Gebete sprechen Gilgamesch im Jenseits als Richter in der Unterwelt an, dessen Weisheit mit den berühmten griechischen Richtern der Unterwelt, Rhadamanthus, Minos und Aiacus, vergleichbar ist. Im „Gilgamesch-Epos“ halten die Götter den großen König für zu stolz und arrogant und so beschließen sie, ihm eine Lektion zu erteilen, indem sie den wilden Mann Enkidu schicken, um ihn zu demütigen. Enkidu und Gilgamesch werden nach einem erbitterten Kampf, in dem keiner besiegt wird, Freunde und begeben sich gemeinsam auf Abenteuer. Als Enkidu vom Tod getroffen wird, verfällt Gilgamesch in tiefe Trauer.
Er erkennt seine eigene Sterblichkeit durch den Tod seines Freundes und stellt den Sinn des Lebens und den Wert menschlicher Leistung angesichts der endgültigen Ausrottung in Frage. Gilgamesch wirft all seine alte Eitelkeit und seinen Stolz ab und macht sich auf die Suche nach dem Sinn des Lebens und schließlich nach einem Weg, den Tod zu besiegen. Damit wird er zum ersten epischen Helden der Weltliteratur. Die Trauer Gilgameschs und die Fragen, die der Tod seines Freundes aufwirft, berühren jeden Menschen, der angesichts des Todes mit dem Sinn des Lebens gerungen hat. Obwohl es Gilgamesch in der Geschichte letztendlich nicht gelingt, Unsterblichkeit zu erlangen, leben seine Taten durch das geschriebene Wort weiter, und das gilt auch für ihn.
Da „Das Gilgamesch-Epos“ lange vor seiner Niederschrift in mündlicher Form existierte, gab es viele Debatten darüber, ob die erhaltene Erzählung eher frühsumerischen oder später babylonischen kulturellen Einfluss hat. Die am besten erhaltene Version der Geschichte stammt von dem babylonischen Schriftsteller Shin-Leqi-Unninni (schrieb 1300–1000 v. Chr.), der die ursprüngliche Geschichte übersetzte, redigierte und möglicherweise ausschmückte. Hierzu schreibt der sumerische Gelehrte Samuel Noah Kramer :
„Von den verschiedenen Episoden des Gilgamesch-Epos gehen mehrere auf sumerische Prototypen zurück, an denen tatsächlich der Held Gilgamesch beteiligt ist. Selbst in den Episoden, in denen es keine sumerischen Gegenstücke gibt, spiegeln die meisten einzelnen Motive sumerische mythische und epische Quellen wider. In keinem Fall haben die babylonischen Dichter jedoch das sumerische Material sklavisch kopiert. Sie modifizierten den Inhalt und formten die Form entsprechend ihrem eigenen Temperament und Erbe so, dass nur noch der nackte Kern des sumerischen Originals erkennbar blieb. Was die Handlungsstruktur des Epos als Ganzes betrifft – das kraftvolle und schicksalhafte episodische Drama des ruhelosen, abenteuerlustigen Helden und seiner unvermeidlichen Desillusionierung – handelt es sich definitiv eher um eine babylonische als um eine sumerische Entwicklung und Errungenschaft.“
Historische Beweise für Gilgameschs Existenz finden sich in Inschriften, die ihm den Bau der großen Mauern von Uruk (heutiges Warka, Irak) zuschreiben. In der Geschichte handelt es sich dabei um die Tafeln, auf denen er erstmals seine großen Taten und seine Suche nach der Bedeutung festhält des Lebens. Es gibt weitere Hinweise auf ihn durch bekannte historische Persönlichkeiten seiner Zeit (26. Jahrhundert v. Chr.), wie etwa König Enmebaragesi von Kish und natürlich die sumerische Königsliste und die Legenden, die um seine Herrschaft herum entstanden.
Auch heute noch wird über Gilgamesch gesprochen und geschrieben. Ein deutsches Archäologenteam behauptet, das Grab von Gilgamesch im April 2003 n. Chr. entdeckt zu haben. Archäologische Ausgrabungen, die mit moderner Technologie und Magnetisierung im und um das alte Flussbett des Euphrat durchgeführt wurden, haben Gartenanlagen, spezifische Gebäude und Strukturen entdeckt, die in beschrieben werden Gilgamesch-Epos einschließlich des Grabes des großen Königs. Der Legende nach wurde Gilgmesh auf dem Grund des Euphrat begraben, als sich das Wasser nach seinem Tod teilte. [Enzyklopädie der antiken Geschichte].
ÜBERPRÜFEN: Von Genesis bis „Beach Blanket Babylon“ haben nur wenige Städte so viele Legenden und Kunstwerke (ganz zu schweigen von musikalischen Parodien) inspiriert wie die mesopotamische Hauptstadt Babylon. Eine Ausstellung, die durch Europa tourt, soll sowohl die Mythen als auch die Realität hinter der antiken Metropole feiern, die heute ein Symbol des modernen Irak ist. „Babylon“, das im Louvre eröffnet wurde und im Berliner Pergamonmuseum und im Britischen Museum gezeigt wird, konzentriert sich auf Artefakte aus der Zeit von den Anfängen der Stadt um 2300 v. Chr. bis zu ihrer Aufgabe im zweiten Jahrhundert n. Chr
Die Ausstellung zeigt auch Gemälde wie die Öl-auf-Holz-Fantasie von Pieter Brueghel dem Älteren aus dem Jahr 1563, „Der kleine“ Turmbau zu Babel, sowie Zeichnungen, Bücher und Filme über die Stadt. Babylon beeindruckt die Welt seit langem mit seinem militärischen Können und seinen kulturellen Errungenschaften, zu denen der 12-Monats-Kalender, wissenschaftliche Gewichte und Maße sowie dynastische Chroniken gehören, die die Schriften der Bibel beeinflusst haben. Am Eingang der Ausstellung steht die berühmte, sieben Fuß hohe Basaltstele mit der Inschrift des Kodex von Hammurabi (reg. 1792–1750 v. Chr.), dem ersten kodifizierten Gesetzeswerk. An anderer Stelle erzählen Tontafeln vom Gilgamesch-Epos und der großen Sintflut.
Die Wahrnehmung der Stadt hat sich mit dem Zeitgeist verändert. Für den griechischen Historiker Herodot aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. übertraf Babylon „an Pracht jede Stadt der bekannten Welt“. Während der protestantischen Reformation im 16. Jahrhundert galt der Turm zu Babel als Symbol der Revolte des Menschen gegen Gott. Doch zur Zeit der Aufklärung im 18. Jahrhundert galt der Turm als außergewöhnliche Meisterleistung der Ingenieurskunst. Die Babylonier erlebten ein goldenes Zeitalter unter Nebukadnezar II. (reg. 605–562 v. Chr.), der die ummauerte Stadt restaurierte und auf eine Fläche von fast vier Quadratmeilen erweiterte und die Hängenden Gärten errichtete.
Doch als er 587 v. Chr. Jerusalem zerstörte und die Juden nach Babylon deportierte, sorgte Nebukadnezar II. dafür, dass die Stadt zum Synonym für Dekadenz und Böses wurde. (Der heilige Augustinus verurteilte sie als „Anti-Jerusalem“.) Auch die anderen berühmten Herrscher der Stadt nehmen in der Ausstellung einen herausragenden Platz ein. Die Zeit der persischen Besatzung (559–331 v. Chr.) wird durch Fragmente einer Stele von Dareios I. mit seinem Fuß auf der Brust eines besiegten Rebellenkönigs dargestellt. Eine Marmorskulptur des Kopfes Alexanders des Großen erinnert an die Pläne des mazedonischen Herrschers, Babylon wieder zu seinem früheren Glanz zu verhelfen, ein Ziel, das bei seinem Tod dort im Jahr 323 v. Chr. nicht verwirklicht wurde
Seltsamerweise thematisiert die Ausstellung nicht die jüngste Vergangenheit Babylons. Saddam Hussein nannte sich den neuen Nebukadnezar und errichtete nicht nur einen, sondern gleich zwei kitschige Paläste auf der antiken Stätte. Nach der US-geführten Invasion im Jahr 2003 beschädigten amerikanische Streitkräfte die archäologischen Überreste weiter, indem sie Gräben aushoben, einen Hubschrauberlandeplatz errichteten und archäologische Ablagerungen zum Füllen von Sandsäcken nutzten. Es gibt Pläne, den Ort zu restaurieren und ihn schließlich in ein Touristenziel umzuwandeln, aber im Moment ist eine europäische Hauptstadt so nah wie möglich an Babylon. [Archäologisches Institut von Amerika].
ÜBERPRÜFEN: Obwohl Akkadisch als gesprochene Sprache in Mesopotamien gegen Ende des ersten millennium v. Chr. ausstarb, wurde die Keilschrift weiterhin von Tempelschreibern und Astrologen verwendet. Es ist bekannt, dass griechische Gelehrte in dieser Zeit nach Babylon strömten, um Astronomie zu lernen, und ausgegrabene Tafeln mit griechischen und akkadischen Inschriften zeigen, dass zumindest einige dieser Gastastronomen sogar versuchten, die Kunst des Keilschriftschreibens zu beherrschen. Aber das Ende war nahe. Die letzten bekannten Tafeln, die datiert werden können, stammen aus dem späten ersten Jahrhundert n. Chr
Einige Gelehrte gehen davon aus, dass die Keilschrift zu dieser Zeit nicht mehr verwendet wurde, doch der Assyriologe Markham Geller von der Freien Universität Berlin geht davon aus, dass sie noch weitere zwei Jahrhunderte Bestand hatte. Er verweist auf klassische Quellen, in denen erwähnt wird, dass die babylonischen Tempel weiterhin florierten, und glaubt, dass es dort immer noch Schriftgelehrte gab, die in der Lage waren, Keilschrift zu lesen und zu schreiben, um sicherzustellen, dass die Rituale ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Er geht außerdem davon aus, dass medizinische Texte in Keilschrift auch in dieser Zeit weiterhin zur Diagnose von Krankheiten verwendet wurden.
Doch im dritten Jahrhundert n. Chr. eroberte das benachbarte Sassanidenreich, das als feindlich gegenüber fremden Religionen bekannt war, Babylon. „Sie haben die Tempel geschlossen“, sagt Geller, „und sie haben alle nach Hause geschickt.“ Er glaubt, dass die reichen, 3.000 Jahre alten Keilschriftaufzeichnungen erst nach dem Tod des allerletzten dieser Tempelschreiber endgültig verstummten. [Archäologisches Institut von Amerika].
ÜBERPRÜFEN: Die 4.000 Jahre alte Stadt Babylon steht vor vielen Herausforderungen. Archäologen sind sich einig, dass die Restaurierungsarbeiten unter Saddam Hussein in den 1980er Jahren den antiken Überresten Schaden zugefügt haben und weiterhin Probleme bereiten. Der Diktator begann, auf den Ruinen eine Nachbildung des Palastes von Nebukadnezar II. zu errichten, und fügte nach dem Golfkrieg einen modernen Palast daneben hinzu. Im Jahr 2003 besetzten US-Truppen den neuen Palast. Besucher können den Basketballkorb sehen, den sie in den Wänden installiert haben. Zurückgebliebener Ziehharmonikadraht wurde wiederverwendet, um Touristen von einer 2.500 Jahre alten Löwenstatue fernzuhalten. Durch den östlichen Teil des Geländes verläuft mittlerweile eine Ölpipeline. „Es geht durch die Außenmauer Babylons“, sagte Reiseleiter Hussein Al-Ammari. Nur zwei Prozent von Babylon wurden ausgegraben, aber die lokale Entwicklung greift weiterhin auf das Gelände ein. [Archäologisches Institut von Amerika].
ÜBERPRÜFEN: Laut einem Bericht im Guardian ist eine 3.700 Jahre alte Keilschrifttafel an der Columbia University mit der ältesten und genauesten funktionierenden trigonometrischen Tabelle der Welt beschriftet. Gelehrte des frühen 20. Jahrhunderts vermerkten die pythagoräischen Tripel auf der Tafel, wussten jedoch nicht, wie die Zahlen verwendet wurden. Die Mathematiker Daniel Mansfield und Norman Wildberger von der University of New South Wales sagen, dass die Berechnungen auf Plimpton 322, wie die babylonische Tafel genannt wird, die Formen rechtwinkliger Dreiecke auf der Grundlage von Verhältnissen beschreiben, während moderne trigonometrische Tabellen auf Messungen von Winkeln und Kreisen basieren.
Babylonische Mathematiker verwendeten für ihre Berechnungen die Basis 60 anstelle der Basis 10, was genauere Brüche ermöglichte. Darüber hinaus erklärten Mansfield und Wildberger, dass Plimpton 322 vier Spalten und 15 Zahlenreihen für eine Folge von 15 rechtwinkligen Dreiecken mit abnehmender Neigung enthält. Aufgrund der Mathematik hatte die zerbrochene Tabelle jedoch ursprünglich wahrscheinlich sechs Spalten und 38 Zahlenreihen. Die Forscher glauben, dass die großen Zahlen auf der Tabelle dazu verwendet werden könnten, Land zu vermessen und zu berechnen, wie man Tempel, Paläste und Stufenpyramiden baut. [Archäologisches Institut von Amerika].
: Wir versenden Bücher im Inland (innerhalb der USA) immer über USPS VERSICHERT Medienpost („Buchpreis“). Es gibt auch ein Rabattprogramm, mit dem Sie die Versandkosten um 50 % bis 75 % senken können, wenn Sie etwa ein halbes Dutzend Bücher oder mehr (ab 5 Kilo) kaufen. Unsere Versandkosten sind so günstig, wie es die USPS-Tarife zulassen. ZUSÄTZLICHE KÄUFE erhalten Sie eine SEHR GROSS
Ihr Einkauf wird in der Regel innerhalb von 48 Stunden nach Zahlungseingang versandt. Wir verpacken so gut wie jeder andere in der Branche, mit viel Schutzpolsterung und Behältern. Für bestimmte Länder stellt der USPS die internationale Sendungsverfolgung kostenlos zur Verfügung, für andere Länder fallen zusätzliche Kosten an.
Wir bieten US Postal Service Priority Mail, Einschreiben und Expresspost sowohl für internationale als auch inländische Sendungen sowie United Parcel Service (UPS) und Federal Express (Fed-Ex) an. Bitte fordern Sie ein Preisangebot an. Bitte beachten Sie, dass wir für internationale Käufer alles tun werden, um Ihre Haftung für Mehrwertsteuer und/oder Zölle zu minimieren. Wir können jedoch keine Verantwortung oder Haftung für etwaige Steuern oder Abgaben übernehmen, die im Land Ihres Wohnsitzes auf Ihren Kauf erhoben werden. Wenn Ihnen die Steuer- und Abgabenregelungen Ihrer Regierung nicht gefallen, beschweren Sie sich bitte bei ihnen. Wir haben keine Möglichkeit, die Steuer-/Zölleregelungen Ihres Landes zu beeinflussen oder zu moderieren.
Sollten Sie nach Erhalt des Artikels aus irgendeinem Grund enttäuscht sein, biete ich Ihnen ein 30-tägiges Rückgaberecht ohne Fragen an. Bitte beachten Sie, dass eBay KEINE Zahlungsabwicklungsgebühren erstattet. Auch wenn Sie „versehentlich“ etwas kaufen und den Kauf dann vor dem Versand stornieren, erstattet eBay Ihnen die Bearbeitungsgebühren nicht. Wenn Sie mit der eBay-Richtlinie „keine Rückerstattung von Gebühren“ unzufrieden sind und wir damit EXTREM unzufrieden sind, äußern Sie bitte Ihren Unmut, indem Sie eBay kontaktieren. Wir haben keine Möglichkeit, die eBay-Richtlinien zu beeinflussen, zu ändern oder außer Kraft zu setzen.
ÜBER UNS: Vor unserer Pensionierung reisten wir mehrmals im Jahr nach Osteuropa und Zentralasien, um in den weltweit produktivsten Edelsteinproduktions- und -schleifzentren nach antiken Edelsteinen und Schmuck zu suchen. Die meisten der von uns angebotenen Artikel stammen aus Ankäufen, die wir in diesen Jahren in Osteuropa, Indien und der Levante (östliches Mittelmeer/Naher Osten) bei verschiedenen Institutionen und Händlern getätigt haben. Ein Großteil unserer Einnahmen auf Etsy, Amazon und Ebay fließt in die Unterstützung wertvoller Institutionen in Europa und Asien, die sich mit Anthropologie und Archäologie befassen. Obwohl wir über eine Sammlung antiker Münzen verfügen, die sich auf Zehntausende beläuft, sind unsere Hauptinteressen antiken/antiken Schmuck und Edelsteine, ein Spiegelbild unseres akademischen Hintergrunds.
Auch wenn es in den USA vielleicht schwierig ist, antike Edelsteine zu finden, werden in Osteuropa und Zentralasien häufig antike Edelsteine aus alten, zerbrochenen Fassungen demontiert – das Gold wird wiederverwendet – und die Edelsteine neu geschliffen und zurückgesetzt. Bevor diese wunderschönen antiken Edelsteine neu geschliffen werden, versuchen wir, die besten davon in ihrem ursprünglichen, antiken, handgefertigten Zustand zu erwerben – die meisten von ihnen wurden ursprünglich vor einem Jahrhundert oder mehr gefertigt. Wir glauben, dass die von diesen längst verstorbenen Meisterhandwerkern geschaffenen Werke es wert sind, geschützt und bewahrt zu werden, anstatt dieses Erbe antiker Edelsteine durch Nachschleifen des Originalwerks zu zerstören. Indem wir ihre Arbeit bewahren, bewahren wir gewissermaßen ihr Leben und das Erbe, das sie der Neuzeit hinterlassen haben. Es ist weitaus besser, ihr Handwerk zu schätzen, als es durch modernes Schneiden zu zerstören.
Nicht alle sind sich einig – mindestens 95 % der antiken Edelsteine, die auf diesen Märkten angeboten werden, sind neu geschliffen und das Erbe der Vergangenheit geht verloren. Wenn Sie jedoch mit uns darin übereinstimmen, dass die Vergangenheit schützenswert ist und dass frühere Leben und die Ergebnisse dieser Leben auch heute noch von Bedeutung sind, sollten Sie den Kauf eines antiken, handgeschliffenen, natürlichen Edelsteins in Betracht ziehen, statt eines in Massenproduktion hergestellten maschinell geschliffenen (häufig synthetischen). oder „im Labor hergestellte“ Edelsteine, die heute den Markt dominieren. Wir können die meisten antiken Edelsteine, die Sie bei uns kaufen, in Stilen und Metallen Ihrer Wahl fassen, von Ringen über Anhänger bis hin zu Ohrringen und Armbändern. aus Sterlingsilber, 14-karätigem Massivgold und 14-karätiger Goldfüllung. Gerne stellen wir Ihnen für jeden Artikel, den Sie bei uns kaufen, ein Zertifikat/Echtheitsgarantie aus. Ich werde immer auf jede Anfrage antworten, egal ob per E-Mail oder eBay-Nachricht, also zögern Sie nicht, mir zu schreiben.
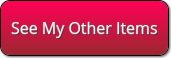
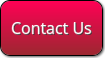
| Publisher | British Museum (2005) |
| Length | 48 pages |
| Dimensions | 8¼ x 5¾ inches |
| Format | Oversized softcover |